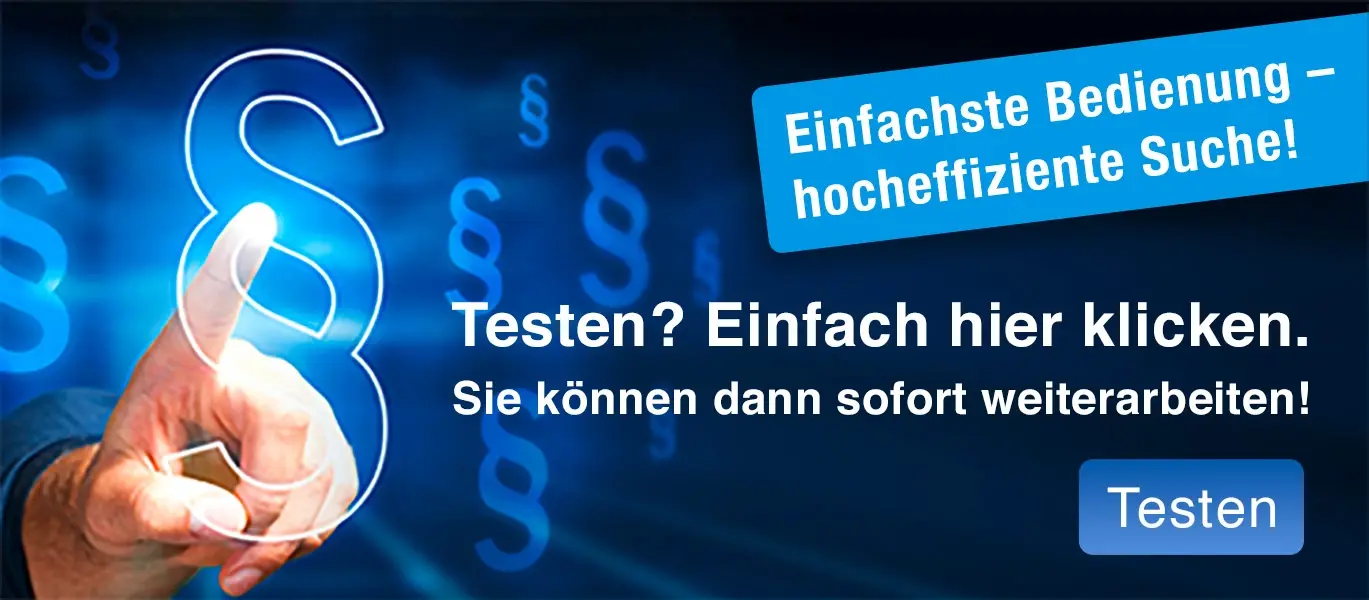
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Zahlungsverjährung, Unterbrechung durch Zahlungsaufforderung
Zahlungsverjährung, Unterbrechung durch Zahlungsaufforderung: 1. Ist die Frist der Zahlungsverjährung durch eine Zahlungsaufforderung des FA unterbrochen worden, steht es nicht in der Macht des FA, die Unterbrechungswirkung durch einen actus contrarius (hier: Erklärung als "erledigt") zu beseitigen. - 2. Zur Würdigung einer solchen Erklärung als öffentlich-rechtlicher Vertrag. - Urt.; BFH 28.11.2006, VII R 3/06; SIS 07 16 98
Verschiedenes > Verjährung, Verwirkung
-
BFH 28.11.2006, VII R 3/06
BStBl 2009 II S. 575
LEXinform 5004693
Anmerkungen:
zur Veröffentlichung in BStBl II bestimmt nach BMF-Online vom 14.7.2009
T.C. in DStZ 13/2007 S. 408
R.R.in StC 7/2007 S. 12 zu 7
[AO 1977] § 228, § 231 Abs. 1
- vor: Schleswig-Holsteinisches FG, 01.12.2005, SIS 06 10 20, Abrechnungsbescheid, Zahlungsverjährung, Unterbrechung, Zahlungsaufforderung, Aufhebung, Rückwirkung, Realakt
- BFH 21.12.2021, SIS 22 04 74, Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine BZSt-Online-Anfrage: 1. Die für eine Verjährungsunterbrec...
- FG Düsseldorf 9.12.2020, SIS 21 02 26, Unterbrechung der Zahlungsverjährung, Aufhebung eines Steuerbescheids mit Leistungsgebot, kein rückwirken...
- Niedersächsisches FG 11.7.2019, SIS 19 14 65, Abrechnungsbescheid über Zahlungsverjährung, Kompetenz des Finanzamts zum Erlass eines Abrechnungsbeschei...
- BFH 17.9.2014, SIS 14 32 47, Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine EMA (Einwohnermeldeamt)-Online-Anfrage: Die für eine Verj...
- BFH 19.8.2013, SIS 14 04 25, Auslegung eines Einspruchsschreibens: 1. Auch wenn im Rubrum eines Einspruchsschreibens ein "Bescheid übe...
- BFH 19.8.2013, SIS 13 32 74, Auslegung eines Einspruchsschreibens: 1. Auch wenn im Rubrum eines Einspruchsschreibens ein "Bescheid übe...
- FG Köln 27.11.2012, SIS 13 08 83, Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch EMA-Online-Anfrage: Eine EMA-Online-Anfrage zur Ermittlung des...
- BFH 9.11.2011, SIS 12 07 77, Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Personengesellschaft bei vorheriger Veräußerung einer wesent...
- BFH 21.6.2010, SIS 10 22 29, Unterbrechung der Zahlungsverjährung auch bei rechtswidriger Aufforderung zur Abgabe der eidesstattlichen...
- BFH 23.2.2010, SIS 10 15 08, Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch Schriftsatz des HZA im AdV-Verfahren: Teilt das HZA im AdV-Ver...
- FG München 7.5.2008, SIS 08 29 72, Ladung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung unter Verstoß gegen § 284 Abs. 4 Satz 3 AO ist nicht ...
- Sächsisches FG 6.12.2007, SIS 08 18 72, Zahlungsverjährung bei Rückforderung der gemeinsam gegenüber den Ehegatten festgesetzten Eigenheimzulage ...
I. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - FA - ) betreibt seit 1990 gegen den Kläger und Revisionskläger (Kläger) die Vollstreckung wegen Einkommensteuer 1987 nebst Säumnis- und Verspätungszuschlägen. Die Ansprüche sind im Jahr 1990 erstmals fällig geworden. Die Verjährung des Zahlungsanspruches des FA ist u.a. 1994 unterbrochen worden. Eine weitere Unterbrechungsmaßnahme - eine fruchtlose Pfändung am 19.1.1996 - ist nach übereinstimmender Auffassung der Beteiligten und des Finanzgerichts (FG) nicht wirksam geworden.
Bevor die aufgrund der Unterbrechungshandlung von 1994 am 31.12.1999 ablaufende Zahlungsverjährungsfrist endete, hat das FA mit Schreiben vom 30.11.1999 eine Zahlungsaufforderung erlassen, die sich allerdings nicht nur an den Kläger, sondern an diesen und seine mit ihm zusammenveranlagte Ehefrau ungeachtet eines inzwischen ergangenen Aufteilungsbescheides richtete. Der Kläger hat diesen Umstand bei einer Vorsprache im FA am 13.12.1999 gerügt. Nach weiteren Gesprächen sowohl mit dem Kläger als auch mit seiner Ehefrau in den ersten Monaten des Jahres 2000 und einer schriftlichen Zahlungsaufforderung vom 30.10.2000 wandte sich der Kläger mit Schreiben vom 31.10.2000 erneut an das FA. Er nahm dabei Bezug auf die Rücksprache vom 13.12.1999 und erinnerte daran, ihm sei damals auf seine Einwände gegen die Zahlungsaufforderung erklärt worden, dass eine Beschwerde unnötig und die Sache erledigt sei. Der Kläger bat das FA darum, ihm diesen Sachverhalt schriftlich zu bestätigen.
Dem ist das FA mit Schreiben vom 1.11.2000 nachgekommen, das im Wesentlichen folgenden Wortlaut hat:
|
|
„... hiermit bestätige ich Ihnen, dass aufgrund Ihrer Vorsprache an Amtsstelle vom 13.12.1999 die zugrunde liegende Zahlungsaufforderung als erledigt angesehen wurde. Eine Beschwerde Ihrerseits ist unnötig. Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen im Schreiben vom 30.10.2000.“ |
Als das FA 2001 seine Vollstreckungsversuche fortsetzte, machte der Kläger Verjährung geltend. Das FA hat daraufhin den angefochtenen Abrechnungsbescheid erlassen, in dem es festgestellt hat, der Kläger schulde rd. 22.000 EUR Einkommensteuer 1987 nebst rd. 40.000 EUR Säumniszuschlägen und rd. 500 EUR Verspätungszuschlag. Hiergegen richtet sich die - hinsichtlich der Säumniszuschläge auf Teilbeträge eingeschränkte - Klage, die das FG abgewiesen hat. Es urteilte, die wegen vorheriger Unterbrechung am 31.12.1999 endende Verjährungsfrist sei durch die Zahlungsaufforderung vom 30.11.1999 (erneut) unterbrochen worden. Dass in dieser Zahlungsaufforderung gegenüber der Ehefrau des Klägers möglicherweise zu Unrecht Steueransprüche geltend gemacht worden seien, ändere daran ebenso wenig etwas wie die mündliche und später schriftlich bestätigte Aussage des FA, dass die Zahlungsaufforderung als erledigt angesehen werde. Denn eine solche Zahlungsaufforderung sei ein Realakt, der nicht ex tunc beseitigt werden könne. Die zivilrechtliche Einordnung einer Mahnung als geschäftsähnliche Handlung sei in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung. Zum Zeitpunkt der strittigen weiteren Vollstreckungsmaßnahme des FA sei demnach Zahlungsverjährung noch nicht eingetreten.
Gegen dieses Urteil (vgl. SIS 06 10 20) richtet sich die Revision des Klägers zu deren Begründung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen wird:
Die Zahlungsaufforderung, die die Verjährung unterbrochen haben solle, sei kein bloßer Realakt, sondern entspreche einer Mahnung. Sie sei also eine geschäftsähnliche Handlung, auf die die Vorschriften über Willenserklärungen entsprechend anwendbar seien. Im Rahmen der Privatautonomie stehe die Aufrechterhaltung und Wirksamkeit solcher Handlungen folglich zur Disposition der Parteien. Das gelte auch für die schriftliche Geltendmachung eines Anspruches aus dem Steuerschuldverhältnis. Die Qualifikation einer solchen Maßnahme ausschließlich als Realakt werde deren Sinngehalt nicht gerecht. Deshalb könne die Finanzverwaltung die schriftliche Geltendmachung eines Anspruches mit Wirkung ex tunc rückgängig machen.
Selbst wenn es sich im Übrigen um einen bloßen Realakt handele, so meint die Revision weiter, gehe es nicht darum, dass ein Realakt nicht ungeschehen gemacht werden könne, was selbstverständlich sei, sondern um eine Frage der rechtlichen Bewertung der Aufhebung einer Zahlungsaufforderung. Die Interessen des Fiskus geböten es nicht, dieser Wirkung für die Vergangenheit abzusprechen.
Ungeachtet all dessen habe das FG zu Unrecht außer Acht gelassen, dass sich der Kläger auf Treu und Glauben berufen könne. Er habe die mündliche Erklärung des FA am 13.12.1999 und dessen Schreiben vom 1.11.2000 dahin verstehen können und müssen, dass das FA den konkreten Willen zur Geltendmachung aller Rechtswirkungen aus der Zahlungsaufforderung vom 30.11.1999 nicht aufrechterhalten wolle. Dafür spreche auch, dass diese Zahlungsaufforderung offensichtlich an gravierenden Mängeln gelitten habe.
II. Die zulässige Revision ist nicht begründet (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung - FGO - ). Das angefochtene Urteil entspricht dem Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 FGO). Die Verjährung, der die Ansprüche des FA auf Zahlungen aufgrund der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach § 228 der Abgabenordnung (AO 1977) unterliegen und die nach fünf Jahren eintritt, wird nach § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 unterbrochen u.a. durch die schriftliche Geltendmachung des Anspruches; die Verjährungsfrist von fünf Jahren beginnt dann mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung geendet hat, erneut (§ 231 Abs. 3 AO 1977).
Es ist zwischen den Beteiligten nicht strittig und bedarf daher keiner ins Einzelne gehenden Darstellung, dass nach diesen Vorschriften am 31.12.1999 für die Einkommensteuerschuld 1987 des Klägers nebst Nebenforderungen keine Zahlungsverjährung eingetreten wäre, wenn die schriftliche Zahlungsaufforderung des FA vom 30.11.1999 die ihr nach § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 grundsätzlich und unstrittig zukommende verjährungsunterbrechende Wirkung trotz des Schreibens des FA vom 1.11.2000 bzw. des darin bestätigten Gesprächs mit dem Kläger an Amtsstelle vom 13.12.1999 behalten hat.
Das FG hat zutreffend geurteilt, dass dies der Fall ist.
1. Den in § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 aufgeführten Maßnahmen, denen das Gesetz verjährungsunterbrechende Wirkung beimisst, ist gemeinsam, dass es sich um nach außen wirkende Maßnahmen handeln muss, welches Erfordernis der erkennende Senat aus dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit hergeleitet hat; denn bei nur innerdienstlichen Maßnahmen des FA, so hat der Senat ausgeführt, sei für den Betroffenen nicht mit der erforderlichen Klarheit feststellbar, ob der Zahlungsanspruch durch Verjährung erloschen ist oder ob er wegen Unterbrechung der Verjährung weiterhin zur Leistung verpflichtet ist (vgl. Urteile vom 23.4.1991 VII R 37/90, BFHE 164, 392, BStBl II 1991, 742 = SIS 91 17 47, und vom 24.9.1996 VII R 31/96, BFHE 181, 259, BStBl II 1997, 8 = SIS 97 03 66). Die verjährungsunterbrechende Wirkung ist hingegen zumindest nicht bei allen vom Gesetz aufgeführten Maßnahmen davon abhängig, dass sie gegenüber dem Zahlungspflichtigen vorgenommen werden (vgl. z.B. Urteil des Senats vom 17.10.1989 VII R 77/88, BFHE 158, 310, 316, BStBl II 1990, 44 = SIS 90 06 49) oder dass der Zahlungspflichtige überhaupt von ihnen erfährt, wie sich insbesondere an der verjährungsunterbrechenden Wirkung einer Wohnsitzanfrage des FA zeigt, bei der dies im Allgemeinen nicht der Fall ist (vgl. Urteil des Senats vom 21.11.2006 VII R 68/05 = SIS 07 03 25, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt), weshalb eben genanntes Urteil die verjährungsunterbrechende Wirkung der Vollstreckungsmaßnahmen auch dann hat eingreifen lassen, wenn der Zahlungspflichtige im Zeitpunkt der Vornahme derselben nicht verfahrenshandlungsfähig war.
Hieran zeigt sich, dass das Gesetz den in § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 aufgeführten Maßnahmen verjährungsunterbrechende Wirkung im Kern nicht deshalb zuschreibt, weil diese Maßnahmen ein etwaiges Vertrauen des Steuerpflichtigen, seine Steuerschuld nicht mehr bezahlen zu müssen, zerstören, oder dass das Gesetz eine solche vertrauenszerstörende Auswirkung jedenfalls nicht für ein wesensnotwendiges Merkmal der Verjährungsunterbrechung ansieht. Entscheidend ist vielmehr, dass das FA, wie dargelegt, vor Ablauf der regulären (bzw. anderweit unterbrochenen und dadurch neu in Lauf gesetzten) Frist der Zahlungsverjährung den Entschluss fasst, seinen Zahlungsanspruch durchzusetzen, und dies auch über den rein innerdienstlichen Bereich hinaus manifest wird.
So liegt es auch hier. Das FA hat vor Ablauf des Jahres 1999, zu dem der Zahlungsanspruch verjährt wäre, durch die vorgenannte Zahlungsaufforderung seinen (unveränderten) Willen manifest werden lassen, aus der Einkommensteuerfestsetzung 1987 nebst Nebenforderungen gegen den Kläger vorzugehen, um seine diesbezüglichen Forderungen zu realisieren. Diesem „Realakt“ misst das Gesetz verjährungsunterbrechende Wirkung bei. Dass diese Wirkung entfiele, wenn das FA nach Eintritt der verjährungsunterbrechenden Wirkung z.B. seinen Willen, die Steuerforderung, zu realisieren, aufgibt (z.B. weil es sie für nicht durchsetzbar hält oder irrtümlich vom Eintritt der Zahlungsverjährung ausgeht), lässt sich § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 ebenso wenig entnehmen, wie sich aus ihm ein Anhalt dafür gewinnen lässt, dass es in der Macht des FA stünde, die kraft Gesetzes eingetretene verjährungsunterbrechende Wirkung später gleichsam durch einen actus contrarius wieder zu beseitigen. Denn dafür bedürfte es einer gesetzlichen Grundlage, unbeschadet der mitunter im Schrifttum (vgl. statt aller Kruse in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 231 AO Tz. 4, und Kögel in Beermann/Gosch, AO § 231 Rz. 7) angestellten gleichsam naturalistischen Betrachtungsweise, dass ein Realakt, wenn er geschehen ist, nicht ungeschehen gemacht und die durch einen Realakt eingetretene verjährungsunterbrechende Wirkung also nicht durch einen „Widerruf“ der Zahlungsaufforderung beiseite geräumt werden kann. Ob bei Unterbrechungsmaßnahmen, die Verwaltungsakte darstellen und im Rechtsbehelfsverfahren aufgehoben werden, die verjährungsunterbrechende Wirkung aufgrund der für dieses Verfahren einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen wegfällt (so im Ergebnis Kruse in Tipke/Kruse, a.a.O., § 231 AO Tz. 4; anders noch Ruban in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 231 AO Rz. 9 mit Hinweis auf die entsprechende frühere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs) oder ob diese Wirkung in entsprechender Anwendung des § 125 AO 1977 auch bei Maßnahmen, die keine Verwaltungsakte sind, von vornherein fehlen kann (so Frotscher in Schwarz, AO, § 231 Rz. 4), bedarf hier keiner Erörterung; denn jedenfalls lässt sich aus den dazu vertretenen Überlegungen nicht die weitere Folgerung ableiten, auch dort, wo solche Vorschriften nicht einschlägig bzw. entsprechend anwendbar sind, könne das FA die Wirkung von ihm vorgenommener Unterbrechungsmaßnahmen dadurch beseitigen, dass es diese für „erledigt“ erklärt. Dass überdies diese Erklärung des FA im Streitfall die verjährungsunterbrechende Wirkung überhaupt nicht betroffen hat, bedarf deshalb hier noch keiner Vertiefung.
2. Zu Unrecht meint die Revision, die Zahlungsaufforderung des FA habe deshalb keine verjährungsunterbrechende Wirkung mehr, weil sich das FA mit dem Kläger darauf geeinigt hätte, dass sie diese nicht mehr haben solle, und eine solche Einigung ebenso wie bei rechtsgeschäftlichen Erklärungen im Zivilrecht auch im Steuerverfahrensrecht möglich und wirksam sei. Die Revision macht also geltend, das FA habe mit dem Kläger einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen, der es verpflichte, sich auf die Rechtswirkungen der Zahlungsaufforderung vom 30.11.1999 gegenüber dem Kläger nicht zu berufen und folglich von weiteren Vollstreckungsmaßnahmen abzusehen.
Es erscheint mehr als zweifelhaft, ob ein öffentlich-rechtlicher Vertrag dieses Inhalts die von der Revision angenommene Wirkung haben könnte. Jedenfalls trifft es nicht zu, dass dem Gespräch an Amtsstelle im Dezember 1999 und dem späteren Bestätigungsschreiben des FA ein solcher Vertragsschluss entnommen werden kann. Da das FG den in diesem Zusammenhang unstreitigen Sachverhalt nicht unter diesem Gesichtspunkt selbst gewürdigt hat, kann der Senat unbeschadet des § 118 Abs. 2 FGO diese Würdigung selbst vornehmen (vgl. statt aller Urteil des Senats vom 24.8.2004 VII R 50/02, BFHE 206, 488 = SIS 04 39 39). Für sie ist entscheidend, dass es sowohl bei dem Gespräch an Amtsstelle als auch bei der Bitte um ein diesbezügliches Bestätigungsschreiben darum ging, dass das FA zu Unrecht auch die Ehefrau des Klägers zur Zahlung aufgefordert und möglicherweise in seiner Zahlungsaufforderung auch zu Unrecht nicht fällige Einzelbeträge erfasst hatte, und dass der Kläger Klarheit darüber gewinnen wollte, ob er zur Vermeidung von Rechtsnachteilen dies mit einem förmlichen Rechtsbehelf rügen müsse. Dass die Zahlungsaufforderung verjährungsunterbrechende Wirkung hätte und wegen der Unwirksamkeit der zuvor ergangenen Unterbrechungsmaßnahme vom Januar 1996 ohne sie der Zahlungsanspruch des FA alsbald verjähren würde, war den Beteiligten offenbar weder bei dem Gespräch an Amtsstelle noch bei der schriftlichen Bestätigung dieses Vorgangs im Folgejahr bewusst. Die Streitsache ist von ihnen damals unter dem Gesichtspunkt der Zahlungsverjährung überhaupt nicht betrachtet worden. Unter diesen Umständen wäre es jedoch ganz fernliegend anzunehmen, der Kläger habe die mündlichen und schriftlichen Erklärungen des FA dahin verstehen dürfen, dieses wolle sich auf die verjährungsunterbrechende Wirkung der Zahlungsaufforderung vom 30.11.1999 künftig nicht berufen, oder das FA habe dies mit seinen Erklärungen gar zum Ausdruck bringen wollen. Darauf kommt es aber an, ohne dass entscheidend wäre, wie losgelöst von diesen Umständen des Streitfalles die Erklärung zu würdigen wäre, eine Zahlungsaufforderung sei „erledigt“.
3. Der Kläger kann sich schließlich auch nicht auf Treu und Glauben berufen. Ob die verjährungsunterbrechende Wirkung einer der in § 231 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 genannten Maßnahmen unter diesem Gesichtspunkt überhaupt jemals in Frage gestellt werden kann, was nach dem eingangs Ausgeführten zweifelhaft erscheinen mag, kann dahinstehen. Denn das FA hat in seiner Revisionserwiderung zutreffend darauf hingewiesen, dass weder im Zeitpunkt der Besprechung an Amtsstelle noch des Bestätigungsschreibens des FA für den Kläger ernsthaft die Annahme in Betracht kommen könnte, das FA wolle auf die Durchsetzung seiner Forderungen verzichten oder gehe davon aus, dass für diese Zahlungsverjährung eingetreten sei.
Da das Urteil des FG mithin namentlich im Ergebnis dem Bundesrecht entspricht, ist die Revision zurückzuweisen.