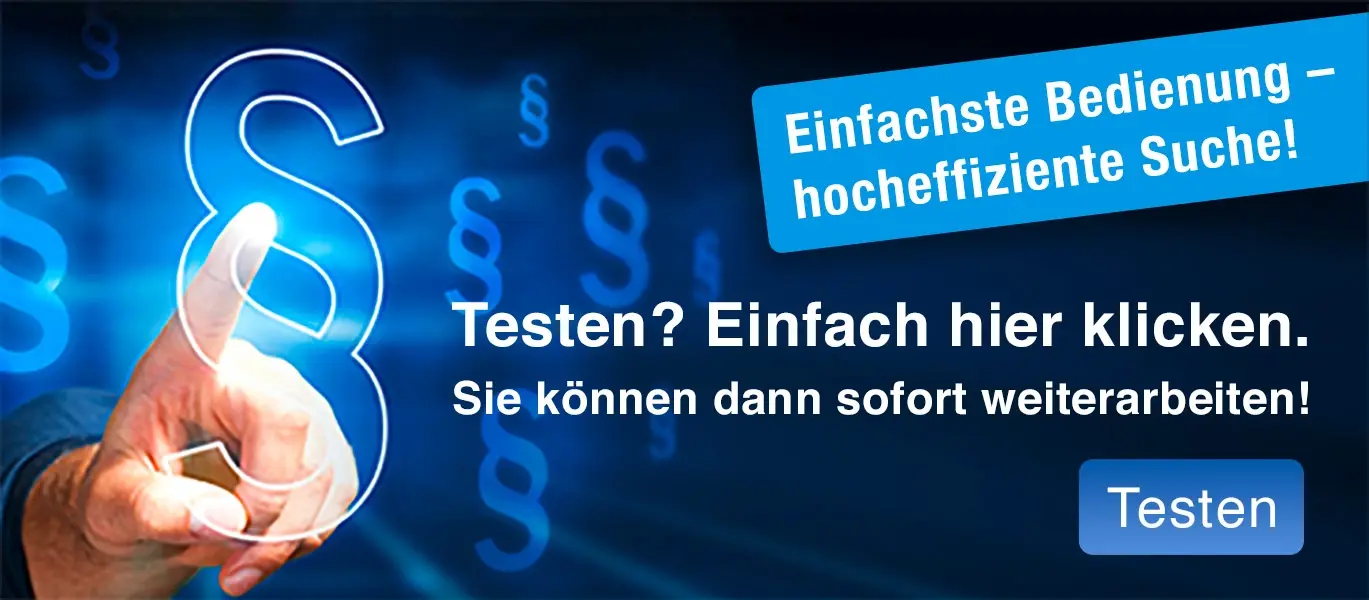Der Beklagte wird verurteilt, an die
Klägerin wegen der unangemessenen Dauer des vor dem
Finanzgericht Sachsen-Anhalt geführten Verfahrens 3 KO 212/17
eine weitere Entschädigung von 1.000 EUR nebst Zinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
seit dem 22.12.2022 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
|
1
|
A. Die Klägerin begehrt
gemäß § 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG)
Entschädigung wegen der aus ihrer Sicht unangemessenen Dauer
des - sich an das Kostenfestsetzungsverfahren zum Klageverfahren 3
K 1135/12 (vormals 3 K 1568/04) anschließenden -
Erinnerungsverfahrens 3 KO 212/17, in welchem über die - nach
dem Kostenfestsetzungsantrag vom 15.01.2014 - gegen den Beschluss
der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle vom 02.01.2017
eingelegte Erinnerung vom 07.02.2017 erst mit teilabhelfendem
Beschluss des Berichterstatters vom 01.08.2022 entschieden
wurde.
|
|
|
|
|
2
|
Dem Ausgangsverfahren liegt der folgende
Sachverhalt zugrunde:
|
|
|
|
|
3
|
Die Klägerin, eine GmbH, erhob im Jahr
2004 beim Finanzgericht (FG) Klage wegen Körperschaftsteuer
1992 sowie gesonderter Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes auf den 31.12.1992, welche sich gegen die
Nichtberücksichtigung von Sonderabschreibungen auf
Bergwerkseigentum in Höhe von 18.769.973,80 DM (9.596.934 EUR)
richtete (Aktenzeichen 3 K 1568/04). Auf die Revision der
Klägerin hob der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom
25.07.2012 - I R 101/10 (BFHE 238, 362, BStBl II 2013, 165 = SIS 12 29 27) das klageabweisende Urteil auf und verwies die Sache an die
Vorinstanz zurück. In dem unter dem neuen Aktenzeichen 3 K
1135/12 fortgeführten Verfahren erließ das Finanzamt
(FA) abhelfende Bescheide, so dass nach Erledigung des
Rechtsstreits in der Hauptsache durch Beschlüsse vom
29.11.2013 und vom 10.12.2013 die Kosten des Verfahrens dem FA
auferlegt wurden und die Zuziehung eines Bevollmächtigten im
Vorverfahren für notwendig erklärt wurde.
|
|
|
|
|
4
|
Am 15.01.2014 beantragte die Klägerin,
die Kosten des Verfahrens 3 K 1135/12 (vormals 3 K 1568/04)
gemäß § 149 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO)
in Höhe von 206.222,54 EUR festzusetzen; demgegenüber
ging das FA von erstattungsfähigen Aufwendungen in Höhe
von 61.237,54 EUR aus. Die Klägerin berechnete den Streitwert
(5.902.679,55 EUR) aus den Erstattungen zur Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer für den Veranlagungszeitraum 1993 und
verwies in einem weiteren Schriftsatz vom 14.02.2014 darauf, dass
zwar die Herabsetzung der Körperschaftsteuer 1993 als konkrete
Auswirkung des Streits, nicht aber (anders als das FA meine) die
gegenläufigen Steuererhöhungen in den Folgejahren (durch
die dann geringeren Sonderabschreibungen) für die
Streitwertbestimmung maßgebend seien.
|
|
|
|
|
5
|
Mit Beschluss vom 25.01.2017 setzte die
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle die vom FA an die
Klägerin zu erstattenden Kosten nach § 149 Abs. 1 FGO auf
lediglich 38.090,24 EUR fest. Sie nahm einen Streitwert von 964.693
EUR an, davon den Auffangstreitwert von 5.000 EUR für die
Körperschaftsteuer und einen Prozentsatz der streitigen
Abschreibungen für die Gewerbesteuer.
|
|
|
|
|
6
|
Mit ihrer Erinnerung vom 07.02.2017
wiederholte die Klägerin ihre Auffassung zum Streitwert unter
Bezugnahme auf den BFH-Beschluss vom 08.09.2003 - III E 1/03
(BFH/NV 2004, 74 = SIS 03 53 00). Die Urkundsbeamtin half der
Erinnerung nicht ab. Während die Klägerin den Vorschlag
des damals für die Erinnerung zuständigen
Berichterstatters zur Abgabe des Erinnerungsverfahrens an den
Güterichter befürwortete, vertrat das FA im Schriftsatz
vom 23.03.2017 die Auffassung, dass eine Kostenentscheidung einer
Güteverhandlung mit gegenseitigem Entgegenkommen nicht
zugänglich sei. Weitere verfahrensbezogene Maßnahmen
sind nicht aktenkundig.
|
|
|
|
|
7
|
Am 18.02.2019 erhob die Klägerin im
Hinblick auf das Erinnerungsverfahren 3 KO 212/17 eine
Verzögerungsrüge.
|
|
|
|
|
8
|
Zugleich stellte sie gegen den damaligen
Berichterstatter einen Befangenheitsantrag, den das FG mit
Beschluss vom 21.10.2019 zurückwies, nachdem die Klägerin
am 02.08.2019 die Gerichtsleitung über die Verfahrensdauer
informiert und am 02.09.2019 eine zweite Verzögerungsrüge
erhoben hatte. Am 07.01.2021 brachte sie schließlich eine
dritte Verzögerungsrüge an.
|
|
|
|
|
9
|
Mit einem Schreiben vom 12.01.2021
thematisierte der Berichterstatter seine Zuständigkeit
für eine Erinnerung gegen den Kostenansatz nach dem
Gerichtskostengesetz (GKG) und gab ferner der Klägerin
Gelegenheit, zu der seines Erachtens wohl fehlenden
Passivlegitimation des FA für das Erinnerungsverfahren
vorzutragen. Die Klägerin beantwortete dieses Schreiben
nicht.
|
|
|
|
|
10
|
Am 23.12.2021 forderte der Berichterstatter
die Klägerin, welche - seiner Meinung nach - für die
Bestimmung des Streitwerts von den konkret-individuellen
Auswirkungen des Streitjahres auf spätere
Veranlagungszeiträume ausging, zur Vorlage entsprechender
aktueller Steuerbescheide auf.
|
|
|
|
|
11
|
Im Schriftsatz vom 14.03.2022 betonte die
Klägerin erneut, dass es nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung für die Streitwertermittlung zwar auf die durch
den Verlustvortrag bewirkte Steuerminderung im Folgejahr 1993, aber
nicht auf sonstige mittelbare steuerliche Auswirkungen auf
Veranlagungszeiträume ankomme, die dem Streitjahr vor- oder
nachgelagert seien. Ungeachtet dessen legte sie die aktuellen
Steuerbescheide für 1992 bis 2007 - wie vom FG gefordert -
vor. Außerdem erkundigte sie sich nach dem Stand ihres
Antrags auf Einleitung eines Güteverfahrens, welches im
Hinblick auf die mehrjährige Verfahrensdauer unverändert
befürwortet werde.
|
|
|
|
|
12
|
Mit Schreiben vom 24.03.2022 teilte das FG
dem FA mit, dass die Berichterstattung zum 01.01.2022 gewechselt
habe. Auf die Frage, ob im vorliegenden Erinnerungsverfahren ein
Güterichterverfahren durchgeführt werden solle, reagierte
das FA mit Schriftsatz vom 14.04.2022 weiterhin ablehnend.
|
|
|
|
|
13
|
Mit Beschluss vom 01.08.2022 - 3 KO 212/17
änderte das FG den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25.01.2017
und setzte die vom FA an die Klägerin zu erstattenden Kosten
nach § 149 Abs. 1 FGO auf 159.739,86 EUR fest. Im Übrigen
wies es die Erinnerung zurück.
|
|
|
|
|
14
|
Am 22.12.2022 hat die Klägerin beim
BFH Entschädigungsklage erhoben.
|
|
|
|
|
15
|
Zur Begründung trägt sie im Kern
vor, die Dauer des Erinnerungsverfahrens beim FG mit über
fünf Jahren sei unangemessen gewesen. Zwar habe der BFH zur
Angemessenheit der Verfahrensdauer bei dieser Verfahrensart noch
nicht entschieden. In Anlehnung an die Rechtsprechung anderer
Gerichtszweige sei aber eine Vorbereitungs- und Bedenkzeit von
regelmäßig zwölf Monaten als ausreichend anzusehen.
Danach liege hier ab März 2018 - zwölf Monate nach der am
07.02.2017 eingelegten Kostenerinnerung - eine Verzögerung
vor. Da nicht bekannt sei, wann genau der Berichterstatter mit der
Bearbeitung des am 01.08.2022 gefassten Beschlusses begonnen habe,
habe die Verzögerung - unterstellt, der Berichterstatter habe
sich ab Juni 2022 in das Verfahren eingearbeitet - bis Mai 2022
angedauert, umfasse mithin mindestens 51 Monate. Die beiden
Schreiben des Berichterstatters vom 12.01.2021 und vom 23.12.2021
hätten das Verfahren erkennbar nicht gefördert. Ausgehend
von dem in § 198 Abs. 2 Satz 3 GVG genannten Jahresbetrag
ergebe sich eine Entschädigung in Höhe von 100 EUR je
Monat, so dass eine Entschädigung von insgesamt 5.100 EUR
nebst Zinsen begehrt werde.
|
|
|
|
|
16
|
Die abweichende Berechnung der
Verzögerungszeiten durch den Beklagten überzeuge nicht
und könne jedenfalls an der Höhe der begehrten
Gesamtentschädigung nichts ändern. Denn angesichts der
eklatanten Verletzung des Gebots auf zeitnahen Rechtsschutz, der
trotz dreimaliger Verzögerungsrügen nicht habe erreicht
werden können, komme hier - in den Grenzen des Klagebegehrens
- die Festsetzung einer höheren monatlichen Entschädigung
wegen Unbilligkeit nach § 198 Abs. 2 Satz 4 GVG in Betracht.
Vorliegend dürfe angesichts eines weiteren, gleichfalls
verzögerten Gerichtsverfahrens bei demselben FG auch die mit
der Geldentschädigung verbundene präventive Wirkung nicht
vernachlässigt werden.
|
|
|
|
|
17
|
Mit Schriftsatz vom 07.09.2023 hat der
Beklagte den geltend gemachten Anspruch in Höhe von 3.500 EUR
nebst hierauf entfallenden Zinsen anerkannt. Nach Überweisung
dieses Betrags durch den Beklagten haben die Beteiligten - zuletzt auch die Klägerin
mit Schriftsatz vom 11.03.2024 - insoweit den Rechtsstreit
übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt
erklärt.
|
|
|
|
|
18
|
Die Klägerin beantragt
sinngemäß,
|
|
|
den Beklagten zu verurteilen, an die
Klägerin wegen der unangemessenen Dauer des vor dem FG
Sachsen-Anhalt geführten Verfahrens 3 KO 212/17 noch eine weitere
Entschädigung in Höhe von 1.600 EUR zuzüglich Zinsen
ab Rechtshängigkeit in Höhe von fünf Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz zu zahlen.
|
|
|
|
|
19
|
Der Beklagte beantragt,
|
|
|
die Klage abzuweisen.
|
|
|
|
|
20
|
Über den anerkannten Umfang hinaus
stehe der Klägerin kein Anspruch auf Zahlung einer
Geldentschädigung zu.
|
|
|
|
|
21
|
Soweit sie eine
entschädigungspflichtige Verzögerung ab März 2018
geltend mache, lasse sie die Rechtsprechung des Senats außer
Betracht, nach welcher der Entschädigungsanspruch im Falle
einer verspätet erhobenen Verzögerungsrüge auf den
Zeitraum von sechs Monaten vor Erhebung der Rüge begrenzt
werde. Da die Klägerin erstmalig am 18.02.2019
Verzögerungsrüge erhoben habe, sei der
Entschädigungsanspruch auf den Zeitraum ab September 2018
begrenzt.
|
|
|
|
|
22
|
Außerdem sei ein angemessener
Zeitraum - von zumindest drei Monaten - bis zu einer gerichtlichen
Entscheidung über den Befangenheitsantrag der Klägerin
aus dem Verzögerungszeitraum herauszurechnen, da der
frühere Berichterstatter bis dahin das Erinnerungsverfahren
nicht habe bearbeiten können. Darüber hinaus stellten
auch das gerichtliche Schreiben vom 23.12.2021 sowie die - von der
Klägerin veranlasste - erneute Anfrage des neuen
Berichterstatters vom 24.03.2022 zur Durchführung eines
Güterichterverfahrens nach dem Maßstab der
Vertretbarkeit verfahrensfördernde Maßnahmen dar. Eine
Entschädigung stehe der Klägerin daher lediglich für
den Zeitraum von September 2018 bis November 2021 abzüglich
von drei Monaten für das Ablehnungsverfahren - ihrer
Berechnung nach für insgesamt 35 Monate - zu.
|
|
|
|
|
23
|
Die Präsidentin des FG hatte der
Klägerin am 19.10.2022 mitgeteilt, dass sie von dem
Berichterstatter eine Stellungnahme angefordert habe. In den Akten
befindet sich eine solche Stellungnahme nicht. Der Beklagte hat
keine vorgelegt.
|
|
|
|
|
24
|
B. I. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache
in Bezug auf die Entschädigung für eine unangemessene
Verfahrensdauer von 35 Monaten in Höhe von 3.500 EUR infolge
der übereinstimmenden Erklärungen der Beteiligten
erledigt. Da die Entschädigung in Geld nach § 198 Abs. 2
Satz 3 GVG nach Monaten bemessen werden kann (ständige
Senatsrechtsprechung, vgl. z.B. Urteil vom 20.08.2014 - X K 9/13,
BFHE 247, 1, BStBl II 2015, 33 = SIS 14 25 64, Rz 38), handelt es
sich bei dem Entschädigungsanspruch um einen quantitativ
teilbaren Streitgegenstand, so dass ein Teilanerkenntnis
möglich ist (vgl. BFH-Urteil vom 29.11.2017 - X K 1/16, BFHE
259, 499, BStBl II 2018, 132 = SIS 17 24 19, Rz 21).
|
|
|
|
|
25
|
II. In Bezug auf den nicht in der Hauptsache
erledigten Teil des Rechtsstreits ist die Klage nur teilweise
begründet.
|
|
|
|
|
26
|
Das finanzgerichtliche
Kostenfestsetzungsverfahren und das sich gegebenenfalls
anschließende Erinnerungsverfahren stellen (einheitlich) ein
Gerichtsverfahren im entschädigungsrechtlichen Sinne dar
(unter 1.). In einem finanzgerichtlichen Kostenfestsetzungs- und
Erinnerungsverfahren ist eine angemessene Verfahrensdauer zu
vermuten, wenn der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle gut sechs
Monate nach Einleitung des Verfahrens durch den
Kostenfestsetzungsantrag, der Richter gut zwölf Monate nach
Eingang der Erinnerung mit der aktiven Bearbeitung beginnt (unter
2.). Die Dauer des hier allein streitgegenständlichen
Erinnerungsverfahrens war über das Anerkenntnis des Beklagten
hinaus in einem weiteren Umfang von lediglich zehn Monaten
unangemessen (unter 3.). Hierfür hat der Beklagte an die
Klägerin eine zusätzliche Entschädigung in Höhe
von insgesamt 1.000 EUR zu leisten, so dass die darüber
hinausgehende Klage unbegründet ist (unter 4.). Der
Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 i.V.m. § 288 Abs. 1
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs - BGB - (unter 5.).
|
|
|
|
|
27
|
1. Bei dem finanzgerichtlichen
Kostenfestsetzungsverfahren und dem sich gegebenenfalls
anschließenden Erinnerungsverfahren handelt es sich um ein
einheitliches Gerichtsverfahren im Sinne des § 198 Abs. 1,
Abs. 6 Nr. 1 Halbsatz 1 GVG.
|
|
|
|
|
28
|
a) Wer infolge unangemessener Dauer eines
Gerichtsverfahrens als Verfahrensbeteiligter einen Nachteil
erleidet, wird angemessen entschädigt (§ 198 Abs. 1 Satz
1 GVG). Im Sinne dieser Vorschrift ist ein Gerichtsverfahren jedes
Verfahren von der Einleitung bis zum rechtskräftigen Abschluss
einschließlich eines Verfahrens auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes und zur Bewilligung von Prozess-
oder Verfahrenskostenhilfe (vgl. § 198 Abs. 6 Nr. 1 Halbsatz 1
GVG).
|
|
|
|
|
29
|
b) Danach ist das hier
streitgegenständliche Erinnerungsverfahren als Teil eines
finanzgerichtlichen Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahrens
tauglicher Gegenstand eines Entschädigungsbegehrens.
|
|
|
|
|
30
|
aa) Das Kostenfestsetzungsverfahren
gemäß § 149 Abs. 1 FGO, mit dem die
Kostengrundentscheidung durch Festsetzung der
erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten umgesetzt
wird, ist ein eigenständiges, vom Hauptsacheverfahren
getrenntes Verfahren (ebenso Urteil des Bundessozialgerichts - BSG
- vom 21.03.2024 - B 10 ÜG 1/23 R, Rz 11, m.w.N.). Es bildet
mit dem sich gegebenenfalls anschließenden
Erinnerungsverfahren ein einheitliches Gerichtsverfahren im Sinne
des § 198 Abs. 1, Abs. 6 Nr. 1 Halbsatz 1 GVG (ebenso zum
sozial- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren BSG-Urteil vom
10.07.2014 - B 10 ÜG 8/13 R, SozR 4-1720 § 198 Nr. 2, Rz
13 sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts - BVerwG - vom
26.02.2021 - 5 C 15.19 D, BVerwGE 171, 388, Rz 8).
|
|
|
|
|
31
|
bb) Ungeachtet dessen kann der
Entschädigungskläger sein Klagebegehren auf einen
bestimmten Verfahrensabschnitt - hier das Erinnerungsverfahren -
beschränken und so den Streitgegenstand und damit auch den
zulässigen Entscheidungsumfang des Entschädigungsgerichts
begrenzen (vgl. die nachfolgenden Ausführungen unter
B.II.3.a).
|
|
|
|
|
32
|
2. Nach § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG richtet
sich die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach den Umständen
des Einzelfalls, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung
des Verfahrens und nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und
Dritter. Diese gesetzlichen Maßstäbe beruhen auf der
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR) und des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG). Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierzu auf das
Senatsurteil vom 07.11.2013 - X K 13/12 (BFHE 243, 126, BStBl II
2014, 179 = SIS 13 32 59, Rz 48 ff.) Bezug genommen.
|
|
|
|
|
33
|
a) Hiernach ist der Begriff der
„Angemessenheit“ für Wertungen
offen, die dem Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse an
einem möglichst zügigen Abschluss des Verfahrens
einerseits und anderen, ebenfalls hochrangigen sowie verfassungs-
und menschenrechtlich verankerten prozessualen Grundsätzen
Rechnung tragen. Dazu gehören der Anspruch auf Gewährung
eines effektiven Rechtsschutzes durch inhaltlich möglichst
zutreffende und qualitativ möglichst hochwertige
Entscheidungen, die Unabhängigkeit der Richter und der
Anspruch auf den gesetzlichen Richter. Danach darf die zeitliche
Grenze bei der Bestimmung der Angemessenheit der Dauer des
Ausgangsverfahrens nicht zu eng gezogen werden. Insbesondere ist
die Dauer eines Gerichtsverfahrens nicht schon dann
„unangemessen“, wenn die Betrachtung
eine Abweichung vom Optimum ergibt; vielmehr muss eine deutliche
Überschreitung der äußersten Grenzen des
Angemessenen feststellbar sein.
|
|
|
|
|
34
|
aa) Dem Ausgangsgericht ist ein erheblicher
Spielraum für die Gestaltung seines Verfahrens - auch in
zeitlicher Hinsicht - einzuräumen. Zwar schließt es die
nach der Konzeption des § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG vorzunehmende
Einzelfallbetrachtung aus, im Rahmen der Auslegung der genannten
Vorschrift konkrete Fristen zu bezeichnen, innerhalb derer ein
Verfahren im Regelfall abschließend erledigt sein sollte.
Allerdings hat der erkennende Senat jedenfalls für ein
finanzgerichtliches Klageverfahren aufgrund der dort vorzufindenden
eher homogenen Fallstrukturen sowie der relativ einheitlichen
Bearbeitungsweise der einzelnen Gerichte und Spruchkörper
für bestimmte typischerweise zu durchlaufende Abschnitte eines
solchen Verfahrens - nicht jedoch für ihre Gesamtdauer -
zeitraumbezogene Konkretisierungen gefunden.
|
|
|
|
|
35
|
(1) Hierfür hat der Senat den Ablauf
eines typischen Klageverfahrens in drei Phasen eingeteilt. Die
erste Phase ist durch die Einreichung und den Austausch
vorbereitender Schriftsätze (§ 77 Abs. 1 Satz 1 FGO)
geprägt, während die sich hieran anschließende
zweite Phase dadurch gekennzeichnet ist, dass das Verfahren -
gerichtsorganisatorisch durch die Gesamtzahl der dem
Spruchkörper oder Richter zugewiesenen Verfahren bedingt -
wegen der Arbeit an anderen Verfahren noch nicht gefördert
werden kann. Die abschließende dritte Phase kann so
umschrieben werden, dass das Gericht Maßnahmen trifft, die
das Verfahren einer Entscheidung zuführen sollen. Ihre Dauer
ist in besonderem Maße vom Schwierigkeitsgrad des Verfahrens,
dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter sowie der
Intensität der Bearbeitung durch das Gericht
abhängig.
|
|
|
|
|
36
|
(2) Zum Zwecke der Typisierung hat der Senat
die Vermutung aufgestellt, dass die Dauer eines finanzgerichtlichen
Klageverfahrens im Sinne von § 198 Abs. 1 GVG noch angemessen
ist, wenn das Gericht gut zwei Jahre nach dem Eingang der Klage mit
Maßnahmen beginnt, die das Verfahren einer Entscheidung
zuführen sollen, und die damit begonnene dritte Phase des
Verfahrensablaufs nicht durch nennenswerte Zeiträume
unterbrochen wird, in denen das Gericht die Akte unbearbeitet
lässt (vgl. Senatsurteil vom 07.11.2013 - X K 13/12, BFHE 243,
126, BStBl II 2014, 179 = SIS 13 32 59, Rz 53 ff.).
|
|
|
|
|
37
|
bb) Bei der Frage, welche gerichtlichen
Maßnahmen als Förderung des Verfahrens zu betrachten
sind, ist dem Spruchkörper zur Ausübung seiner
verfahrensgestaltenden Befugnisse ein weiter Gestaltungsspielraum
zuzubilligen. Die Verfahrensführung des Gerichts darf im
Entschädigungsprozess nicht auf ihre Richtigkeit, sondern nur
auf ihre Vertretbarkeit überprüft werden. Letztere darf
nur verneint werden, wenn bei voller Würdigung auch der
Belange einer funktionstüchtigen Rechtspflege das richterliche
Verhalten nicht mehr verständlich ist (vgl. Senatsurteil vom
23.03.2022 - X K 2/20, BFHE 275, 533, BStBl II 2023, 38 = SIS 22 12 71, Rz 28). Da der Rechtssuchende keinen Anspruch auf optimale
Verfahrensförderung hat, begründen eine vertretbare
Rechtsauffassung des Gerichts oder eine nach der jeweiligen
Prozessordnung vertretbare Verfahrensleitung auch dann keinen
Entschädigungsanspruch, wenn sie zu einer Verlängerung
des Gerichtsverfahrens geführt haben (vgl. Senatsurteil vom
07.05.2014 - X K 11/13, BFH/NV 2014, 1748 = SIS 14 27 19, Rz
41).
|
|
|
|
|
38
|
b) Der Senat hat bereits entschieden, dass
diese für ein erstinstanzliches Klageverfahren vor einem FG
geltende Typisierung nicht ohne Weiteres auf ein isoliert von einem
Hauptsacheverfahren geführtes Verfahren zur Bewilligung von
Prozesskostenhilfe (PKH) übertragen werden kann. Zum Zwecke
der Typisierung und Rechtsvereinfachung kann allerdings der Ablauf
eines solchen Verfahrens ebenfalls in drei Phasen eingeteilt
werden. Insoweit besteht für ein finanzgerichtliches
PKH-Verfahren die Vermutung einer noch angemessenen Dauer
gemäß § 198 Abs. 1 GVG, sofern das Gericht gut acht
Monate nach der Einleitung des Verfahrens mit Maßnahmen zur
Entscheidung beginnt und ab diesem Zeitpunkt nicht für
nennenswerte Zeiträume inaktiv bleibt (vgl. Senatsurteil vom
20.03.2019 - X K 4/18, BFHE 263, 498, BStBl II 2020, 16 = SIS 19 06 36, Rz 56 und Rz 64).
|
|
|
|
|
39
|
c) Es erscheint ebenfalls nicht sachgerecht,
die für das finanzgerichtliche Klageverfahren geltende
Typisierung in gleicher Weise auf das hier zu betrachtende
Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahren zu
übertragen.
|
|
|
|
|
40
|
aa) Ob dies schon daraus folgt, dass nach
einer in der Literatur vertretenen Ansicht im finanzgerichtlichen
Kostenfestsetzungsverfahren nach § 149 FGO - anders als im
finanzgerichtlichen Klage- oder PKH-Verfahren (vgl. hierzu
Senatsurteil vom 20.03.2019 - X K 4/18, BFHE 263, 498, BStBl II
2020, 16 = SIS 19 06 36, Rz 61) - der Untersuchungsgrundsatz nicht
gelten soll, vielmehr wegen der Anwendung der zivilprozessualen
Regeln (§ 155 Satz 1 FGO i.V.m. §§ 103 ff. der
Zivilprozessordnung - ZPO - ) der Verhandlungsgrundsatz und der
Dispositionsgrundsatz zur Anwendung kämen (vgl. Schwarz in
Hübschmann/Hepp/Spitaler - HHSp -, § 149 FGO Rz 11;
Brandis in Tipke/Kruse, § 149 FGO Rz 1), braucht der Senat
nicht zu entscheiden.
|
|
|
|
|
41
|
bb) Jedenfalls unterscheidet sich das in Rede
stehende Verfahren insoweit grundlegend vom finanzgerichtlichen
Klage- beziehungsweise (isolierten) PKH-Verfahren, als es aus zwei
Abschnitten besteht. Für die Kostenfestsetzung ist innerhalb
des Gerichts nach § 149 Abs. 1 FGO zunächst der
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle zuständig, der in einem
justizförmigen Verfahren nach Anhörung des Gegners
eigenverantwortlich und richterähnlich über den Antrag
befindet, ohne an Weisungen gebunden zu sein (vgl. Schwarz in HHSp,
§ 149 FGO Rz 11; Brandis in Tipke/Kruse, § 149 FGO Rz 1).
Erst über die gegen die Kostenfestsetzung eingelegte
Erinnerung entscheidet, wenn der Urkundsbeamte ihr nicht abhilft,
das Gericht durch Beschluss (vgl. § 149 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4
FGO). Für die Entscheidung über die Erinnerung nach
§ 149 Abs. 2 FGO ist, wenn - wie hier - die
Kostengrundentscheidung im vorbereitenden Verfahren ergangen ist,
funktionell der Berichterstatter gemäß § 79a Abs. 1
Nr. 5 i.V.m. Abs. 4 FGO zuständig (vgl. FG des Landes
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14.01.2014 - 3 KO 986/13, EFG 2014,
1229 = SIS 14 14 61, Rz 27, m.w.N.).
|
|
|
|
|
42
|
cc) Im Falle eines Kostenfestsetzungs- und
Erinnerungsverfahrens sind daher nichtrichterliche und richterliche
Tätigkeiten entschädigungsrechtlich
verfahrensmäßig verbunden. Dies steht allerdings einer
eigenständigen Bewertung des jeweiligen Verfahrensabschnitts
in Bezug auf die Frage, was noch als angemessene Verfahrensdauer
anzusehen ist, nicht entgegen.
|
|
|
|
|
43
|
dd) Infolge der unterschiedlichen
Bearbeitungsebenen entspricht das einheitliche Kostenfestsetzungs-
und Erinnerungsverfahren zwar insoweit nicht dem oben dargelegten
typisierten Ablauf eines finanzgerichtlichen Klageverfahrens, als
Letzteres nicht in zwei Abschnitte zerfällt und (lediglich)
einmal drei Phasen umfasst.
|
|
|
|
|
44
|
Auch das Kostenfestsetzungs- sowie das sich
anschließende Erinnerungsverfahren sind aber, jedes für
sich, typischerweise durch Phasen des Verfahrens geprägt, die
von der Einreichung und dem Austausch vorbereitender
Schriftsätze über einen Zeitraum zulässiger
Inaktivität aufgrund der Vielzahl zu erledigender Verfahren
bis hin zu dem Zeitraum reichen, in dem das Verfahren durch
Fördermaßnahmen einer Entscheidung (über den
Kostenfestsetzungsantrag beziehungsweise über die Erinnerung)
zugeführt wird.
|
|
|
|
|
45
|
d) So wie auch sonst im Interesse einer
einheitlichen Rechtsanwendung die Dauer der ersten und zweiten
Phase finanzgerichtlicher Verfahren zu typisieren ist (vgl.
Senatsurteil vom 20.03.2019 - X K 4/18, BFHE 262, 498, BStBl II
2020, 16 = SIS 19 06 36, Rz 62 ff.), besteht für ein
finanzgerichtliches Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahren
die Vermutung einer noch angemessenen Dauer gemäß §
198 Abs. 1 GVG, sofern - in der Regel - der Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle bei der Kostenfestsetzung gut sechs Monate
nach Einleitung des Verfahrens durch den Kostenfestsetzungsantrag,
der Richter im Erinnerungsverfahren gut zwölf Monate nach
Einlegung der Erinnerung in die (dritte) Phase der aktiven
Bearbeitung eintritt, also mit Maßnahmen zur
Herbeiführung einer Entscheidung beginnt und ab diesem
Zeitpunkt nicht für nennenswerte Zeiträume inaktiv
ist.
|
|
|
|
|
46
|
3. Nach diesen Maßstäben war die
Dauer des vorliegend allein in Rede stehenden Erinnerungsverfahrens
(unter a) im Umfang von insgesamt 45 Monaten unangemessen. Nach
Abzug der 35 Monate, die der Beklagte bereits anerkannt hat, ist
eine unangemessene Verfahrensdauer von (lediglich) 10 weiteren
Monaten zu verzeichnen (unter b).
|
|
|
|
|
47
|
a) Gegenstand der vorliegenden
Entschädigungsklage ist allein das Erinnerungsverfahren.
|
|
|
|
|
48
|
aa) Zwar bilden das
Kostenfestsetzungsverfahren und das sich gegebenenfalls
anschließende Erinnerungsverfahren - wie oben dargelegt -
zusammen entschädigungsrechtlich ein (einheitliches)
Gerichtsverfahren im Sinne des § 198 Abs. 1 Satz 1, Abs. 6 Nr.
1 Halbsatz 1 GVG.
|
|
|
|
|
49
|
bb) Der Entschädigungskläger kann
aber sein Klagebegehren auf einen bestimmten Verfahrensabschnitt
beschränken und hierdurch den Streitgegenstand und damit den
zulässigen Entscheidungsumfang des Entschädigungsgerichts
begrenzen (vgl. BSG-Urteil vom 11.06.2024 - B 10 ÜG 3/23 R,
BSGE nn, Rz 17; ebenso BVerwG-Urteil vom 26.02.2021 - 5 C 15.19 D,
BVerwGE 171, 388, Rz 9; Röhl in: Schlegel/Voelzke, juris
Praxiskommentar Sozialgerichtsgesetz, § 198 GVG, (Stand:
18.06.2024), Rz 183.1).
|
|
|
|
|
50
|
cc) Eine solche Beschränkung ist hier
erfolgt. Die Klägerin begehrt eine Entschädigung
ausschließlich wegen der überlangen Dauer des
Erinnerungsverfahrens. Dies ergibt sich eindeutig aus der
Formulierung ihres Klageantrags, der das Verfahren „3 KO
212/17“, also das Erinnerungsverfahren,
betrifft, sowie aus dem Umstand, dass die Klägerin ihr
Entschädigungsbegehren allein auf der Grundlage dieses
Verfahrenszeitraums berechnet hat. Es ist nicht ansatzweise
erkennbar, dass sie auch das Kostenfestsetzungsverfahren zum
Gegenstand der entschädigungsrechtlichen Entscheidung machen
wollte.
|
|
|
|
|
51
|
dd) Soweit zwischen der von der Klägerin
angenommenen Verzögerung (51 Monate) und der
tatsächlichen Verzögerung (45 Monate) eine Lücke von
sechs Monaten verbleibt, kann diese - aufgrund der
prozessrechtlichen Begrenzung - nicht mittels etwaiger
Verzögerungsmonate des nicht streitgegenständlichen
Kostenfestsetzungsverfahrens geschlossen werden.
|
|
|
|
|
52
|
b) Das Erinnerungsverfahren weist eine
unangemessene Verfahrensdauer im Gesamtumfang von (lediglich) 45
Monaten auf. Sie setzt sich zusammen aus den Monaten März 2018
bis Januar 2019 (elf Monate), Juli 2019 bis Februar 2022 (32
Monate) sowie Mai 2022 und Juni 2022 (zwei Monate).
|
|
|
|
|
53
|
aa) Ausgehend von dem Beginn der dritten Phase
nach zwölf Monaten seit Einlegung der Erinnerung am 07.02.2017
hätte das FG das Erinnerungsverfahren ab März 2018 aktiv
auf eine Verfahrensbeendigung hin fördern müssen. In der
Folgezeit ist das Ausgangsgericht jedoch bis zur Erteilung des
rechtlichen Hinweises am 23.12.2021 in der Sache nicht in einer das
Verfahren fördernden Weise tätig geworden.
|
|
|
|
|
54
|
bb) Davon ausgenommen und damit als nicht
verzögert anzusehen ist lediglich die Zeit, binnen derer
über den Befangenheitsantrag der Klägerin vom 18.02.2019
hätte befunden werden müssen. Das umfasst den Zeitraum
von Februar bis Juni 2019.
|
|
|
|
|
55
|
(1) Denn für den betroffenen Richter
besteht eine Wartepflicht. Vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs
darf er lediglich unaufschiebbare Maßnahmen treffen (vgl.
§ 47 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 51 Abs. 1 Satz 1 FGO). Der
damalige Berichterstatter war daher bis zur Entscheidung über
das Ablehnungsgesuch rechtlich daran gehindert, dem
Erinnerungsverfahren in der Sache Fortgang zu geben. Der Monat
Februar 2019 gehört wegen der monatsweisen Berechnung der
Entschädigung daher nicht mehr zu dem
Verzögerungszeitraum.
|
|
|
|
|
56
|
(2) Unter entschädigungsrechtlichen
Aspekten steht allerdings - wie der Beklagte selbst eingeräumt
hat - der vorläufig bis zur tatsächlichen Entscheidung
über den Befangenheitsantrag bestehende Schwebezustand der
Annahme einer Verzögerung nicht zeitlich unbegrenzt entgegen.
Denn die haftende Körperschaft kann sich auf die Wartepflicht
des abgelehnten Richters nur insoweit berufen, als die Entscheidung
über das Ablehnungsgesuch nicht ihrerseits aus in der
gerichtlichen Sphäre liegenden Gründen unangemessen
verzögert wurde.
|
|
|
|
|
57
|
(3) Zwar lassen sich diesbezüglich der
Rechtsprechung keine festen Bearbeitungszeiträume entnehmen
(vgl. z.B. Landessozialgericht - LSG - für das Saarland,
Urteil vom 21.03.2018 - L 2 SF 4/17 EK AS, juris, Rz 34: keine
zögerliche Bearbeitung, wenn das Gericht circa viereinhalb
Monate nach Stellung des Befangenheitsantrags und zwischenzeitlich
beantragter Fristverlängerung zur Antragsbegründung
entscheidet; Thüringer Oberverwaltungsgericht - OVG -, Urteil
vom 08.01.2014 - 2 SO 182/12, Thüringer
Verwaltungsblätter 2014, 165, Rz 79: Zu langsame Bearbeitung
des Befangenheitsantrags, über den erst nach sechs Monaten
entschieden wurde).
|
|
|
|
|
58
|
Allerdings verdichtet sich mit zunehmender
Verfahrensdauer die Pflicht des Gerichts, sich nachhaltig um eine
Förderung, Beschleunigung und Beendigung des Verfahrens zu
bemühen (vgl. Senatsurteil vom 27.06.2018 - X K 3-6/17, BFH/NV
2019, 27 = SIS 18 16 79, Rz 69). Diese Pflicht betrifft nicht nur
den für die Sachentscheidung - hier für das
Erinnerungsverfahren - zuständigen Richter, sondern auch die
zur Entscheidung über den Befangenheitsantrag berufenen
Richter in der Weise, das bereits erheblich verzögerte
finanzgerichtliche Verfahren nicht noch zusätzlich durch
längere Nichtbearbeitung des Ablehnungsgesuchs
ungebührlich zu verzögern. Die überlange
Verfahrensdauer liegt im staatlichen Verantwortungsbereich und ist
nicht auf den jeweiligen Justizangehörigen bezogen (vgl.
Senatsurteil vom 17.04.2013 - X K 3/12, BFHE 240, 516, BStBl II
2013, 547 = SIS 13 14 53, Rz 43).
|
|
|
|
|
59
|
(4) Da im Streitfall allein das
Erinnerungsverfahren im Zeitpunkt der Stellung des
Ablehnungsgesuchs bereits seit circa zwei Jahren anhängig war,
hätte daher der Befangenheitsantrag nach Einschätzung des
Senats jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten -
spätestens im Juni 2019 - beschieden werden müssen. Ab
Juli 2019 ist daher wiederum von einer verfahrensverzögernden
Inaktivität auszugehen.
|
|
|
|
|
60
|
cc) Die nächste Verfahrenshandlung des
FG, das Schreiben des Berichterstatters vom 12.01.2021,
förderte das Verfahren nicht und unterbrach deshalb den
Verzögerungszeitraum nicht. Sie kann auch unter Beachtung des
weiten Gestaltungsspielraums des Gerichts nicht mehr als vertretbar
qualifiziert werden, weil sie eine falsche Prozesssituation
annimmt. Das Kostenfestsetzungsverfahren nach § 149 FGO ist
ein anderes Verfahren als der Ansatz der Gerichtsgebühren
sowie gegebenenfalls ein Erinnerungsverfahren nach dem
Gerichtskostengesetz. Im Kostenfestsetzungsverfahren muss der
Gegner des Ursprungsverfahrens Beteiligter sein, weil er zur
Erstattung der fraglichen Kosten verpflichtet werden soll. Soweit
im Rubrum der dritten Verzögerungsrüge vom 07.01.2021
formuliert ist „wg. Erinnerung
Kostenansatz“, handelte es sich offenkundig um
ein sprachliches Versehen; ein Eingehen darauf war
überflüssig. Unerheblich ist, dass die Klägerin auf
das Schreiben vom 12.01.2021 nicht mehr reagiert hatte. Reagiert
der Adressat auf eine nicht verfahrensfördernde Verfügung
nicht, kann das nicht dazu führen, dass der Monat, in den die
objektiv unnötige gerichtliche Handlung fällt, als Teil
der angemessenen Verfahrensdauer angesehen werden kann.
|
|
|
|
|
61
|
dd) Soweit schließlich das FG die
Klägerin mit Schreiben vom 23.12.2021 zur Vorlage aktueller
Steuerbescheide aufforderte, die die Klägerin mit Schriftsatz
vom 14.03.2022 zur Verfügung stellte, beruht diese
Maßnahme ebenfalls nicht mehr auf vertretbarer aktiver
Verfahrensgestaltung und vermag den Zeitraum bis März 2022
daher nicht aus dem Verzögerungszeitraum auszunehmen.
|
|
|
|
|
62
|
(1) Die Anforderung von Steuerbescheiden
gegenüber der Klägerin erfolgte nämlich nicht, weil
sich der Richter diesbezüglich eine eigene Rechtsauffassung
gebildet gehabt hätte und ihm deshalb eine weitere
Sachverhaltsaufklärung erforderlich erschien. Vielmehr hat er
sich auf eine vermeintliche Rechtsauffassung der Klägerin
gestützt, die diese jedoch in dieser Form nicht vertreten
hatte. Sie hatte zwar tatsächlich den Streitwert nach den
„konkreten“ steuerlichen Auswirkungen
berechnet. Damit hatte sie jedoch unmissverständlich im
Einklang mit der ständigen höchstrichterlichen
Rechtsprechung zur damaligen Rechtslage (für Verfahren, die ab
dem 01.08.2013 eingeleitet worden sind, vgl. aber § 52 Abs. 3
Satz 2, § 71 Abs. 1 Satz 1 GKG) nur direkte, nicht aber
mittelbare steuerliche Auswirkungen auf Veranlagungszeiträume
gemeint, die dem Streitjahr vor- oder nachgelagert seien. In ihrem
Schriftsatz vom 14.03.2022 hat sie diese Auffassung später
noch einmal bestätigt.
|
|
|
|
|
63
|
(2) Einer Aufklärungsverfügung ohne
eigene Prüfung die Rechtsauffassung eines Beteiligten zugrunde
zu legen wäre aber, wenn überhaupt, allenfalls noch als
vertretbar anzusehen gewesen, wenn es sich tatsächlich um die
Rechtsauffassung dieses Beteiligten gehandelt hätte und die
Aufklärungsverfügung insoweit folgerichtig gewesen
wäre. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die
Verfügung auch von dem Umstand getragen war, dass kurz darauf
der Richter die Zuständigkeit für die Sache verlor und er
dies bereits wusste und möglicherweise deshalb den Schein
einer Aktivität erwecken wollte.
|
|
|
|
|
64
|
ee) Der Monat Januar 2022 und gegebenenfalls
eine gewisse weitere Zeit danach sind auch nicht deshalb als
Verfahrensförderungszeit zu betrachten, weil zum 01.01.2022
der Berichterstatter gewechselt hatte und sich der neue
Berichterstatter naturgemäß in das ihm bisher unbekannte
Verfahren einarbeiten musste.
|
|
|
|
|
65
|
(1) Die Frage, ob beziehungsweise in welchem
Umfang nach einem Wechsel in der Berichterstattung eine
Einarbeitungszeit zu gewähren ist, die ungeachtet einer nicht
nach außen in Erscheinung tretenden Aktivität nicht als
Verzögerungszeit zu werten wäre, ist nach
entschädigungsrechtlichen Aspekten zu beantworten.
|
|
|
|
|
66
|
(a) Nach der Rechtsprechung des BVerfG sind
dem Staat auch solche Verzögerungen zuzurechnen, die durch
eine anderweitige Organisation oder auch gleichmäßige
Sachbearbeitung hätten verhindert werden können (vgl.
stattgebender Kammerbeschluss des BVerfG vom 30.07.2009 - 1 BvR
2662/06, Deutsches Verwaltungsblatt 2009, 1164 = SIS 09 33 46,
unter IV.1.b bb (1); vgl. auch Urteil des LSG Sachsen-Anhalt vom
29.11.2012 - L 10 SF 5/12 ÜG, Anwalt/Anwältin im
Sozialrecht - ASR - 2013, 59, Rz 218).
|
|
|
|
|
67
|
(b) Die Entschädigungsrelevanz des
Zeitraums der Nichtbearbeitung infolge eines
Berichterstatterwechsels ist von dem konkreten Verfahrens-
beziehungsweise Verzögerungsstand einerseits und der
gerichtsorganisatorischen Vermeidbarkeit der Verzögerung
andererseits abhängig. Grundsätzlich ist ein
Berichterstatterwechsel unerheblich, da es nicht darauf ankommt, ob
eine Verzögerung in den Verantwortungsbereich des einzelnen
Richters (hier: des Berichterstatters) oder der
Gerichtsorganisation fällt (vgl. Senatsurteil vom 26.10.2016 -
X K 2/15, BFHE 255, 407, BStBl II 2017, 350 = SIS 16 27 84, Rz
44).
|
|
|
|
|
68
|
In Abhängigkeit von der jeweiligen
konkreten Verfahrenssituation kann es gleichwohl angemessen sein,
nach einem Berichterstatterwechsel einen gewissen Zeitraum für
die Einarbeitung in das Verfahren als Verfahrensförderung zu
qualifizieren. Ein für alle Fallgestaltungen gleicher Zeitraum
für die erforderliche Einarbeitung existiert jedoch nicht.
Soweit das BVerwG in seinem Urteil vom 14.11.2016 - 5 C 10.15 D
(BVerwGE 156, 229, Rz 163) dem neuen Berichterstatter eine
Einarbeitungszeit von (mindestens) einem Monat zugebilligt hat,
beruhte dies auf den Umständen jenes Streitfalls (so
zutreffend Beschluss des OVG für das Land Schleswig-Holstein
vom 22.09.2022 - 4 P 2/19 EK, Zeitschrift für
Öffentliches Recht in Norddeutschland, 2022, 595, Rz 59 f.).
Hätte etwa bei bereits erhöhter Verfahrensdauer und der
sich verdichtenden Pflicht zur Verfahrensförderung unter
stringenter Führung des Gerichts das Verfahren bereits
erledigt werden können (statt, wie im dortigen Fall, auf die
„häppchenweisen“
Teilabhilfeentscheidungen des Beklagten zu warten), so ist
allerdings wegen eines nachfolgenden Berichterstatterwechsels kein
weiterer Zeitraum mehr als Bearbeitungs- und Bedenkzeit abzuziehen
(vgl. Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 28.09.2015 - 13 D
12/15, Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter 2016,
124, Rz 64 f.).
|
|
|
|
|
69
|
(2) Nach den sich aus den Akten ergebenden
Umständen hatte das FG bereits vor dem Berichterstatterwechsel
in nicht hinnehmbarer Weise eine jahrelange
Verfahrensverzögerung geduldet, so dass eine
entschädigungsrechtliche Karenzfrist von ein oder zwei Monaten
für die notwendige Einarbeitung des neuen Berichterstatters
nicht mehr anzusetzen ist. Dies ergibt sich nicht nur daraus, dass
trotz zweier Verzögerungsrügen im Jahr 2019 und einer
dritten Verzögerungsrüge Anfang 2021 vom damaligen
Berichterstatter keinerlei Maßnahmen zur Verfahrensbeendigung
ergriffen wurden. Darüber hinaus war die Gerichtsleitung mit
Schreiben der Klägerin vom 02.08.2019 auf die seinerzeit schon
mehr als fünfjährige Dauer des Kostenfestsetzungs- und
Erinnerungsverfahrens und die Wirkungslosigkeit der ersten
Verzögerungsrüge hingewiesen und um Überprüfung
des Geschäftsgangs gebeten worden. Danach hätte das
Ausgangsgericht bereits lange Zeit vor dem 01.01.2022 durch eine
Änderung der gerichts- oder senatsinternen
Geschäftsverteilung eine Verfahrensförderung und
-beendigung sicherstellen können und müssen.
|
|
|
|
|
70
|
ff) Für die Monate März und April
2022 ist eine Verfahrensförderung durch den neuen
Berichterstatter gegeben.
|
|
|
|
|
71
|
(1) Die mit gerichtlichem Schreiben vom
24.03.2022 wiederholte Anfrage beim FA über dessen
Einverständnis zur Durchführung eines
Güterichterverfahrens, welches vom FA mit Schriftsatz vom
14.04.2022 versagt wurde, erfolgte auf Veranlassung der
Klägerin, die mithin selbst seinerzeit von der Tauglichkeit
der gerichtlichen Maßnahme zur möglichen Beendigung des
Streits bei der Kostenfestsetzung ausging, die sie nunmehr in
Abrede stellt. Die gerichtliche Anfrage bewegte sich deshalb im
Rahmen vertretbarer Verfahrensgestaltung.
|
|
|
|
|
72
|
(2) Zwar lag die Durchführung eines
Güterichterverfahrens von seinem Zweck her, ein
Lösungsangebot bei Streitfällen bereitzustellen, in denen
besondere Konflikte zwischen den Beteiligten bestehen, die
über das eigentliche Rechtsproblem hinausgehen, vorliegend
mangels eines solchen besonderen Konflikts zwischen der
Klägerin und dem FA nicht unbedingt nahe. Im Hinblick auf eine
mögliche Verfahrenserledigung kann dies aber gerade angesichts
der Anregung der Klägerin nicht als völlig ungeeignet
bewertet werden.
|
|
|
|
|
73
|
(3) Dem Vorschlag des FG lag erkennbar die
Vorstellung zugrunde, dass sich die Beteiligten über die
Höhe der außergerichtlichen Kosten hätten einigen
können, ein Güteverfahren deshalb zulässig gewesen
wäre. Diese Auffassung ist auf der Grundlage der oben
genannten Literaturansicht, nach welcher im
Kostenfestsetzungsverfahren der Dispositionsgrundsatz gelte,
vertretbar. Folgte man dieser Ansicht, so bedeutete dies, dass der
zu erstattende Betrag nicht höher festgesetzt werden darf, als
der Antrag des Erstattungsgläubigers reicht, und nicht
niedriger angesetzt werden darf, als der Erstattungsschuldner ihn -
jedenfalls im Rahmen des rechtlich Zulässigen - anerkannt hat
(vgl. dazu Schwarz in HHSp, § 149 FGO Rz 6a, 11; ebenso
Brandis in Tipke/Kruse, § 149 FGO Rz 1). Innerhalb dieses
Rahmens wäre eine Einigung über die Höhe der
außergerichtlichen Kosten möglich - auch im Rahmen eines
Güterichterverfahrens.
|
|
|
|
|
74
|
gg) Für den Zeitraum von Mai 2022 bis
einschließlich Juni 2022 sind gerichtliche
Fördermaßnahmen aus den vorliegenden Akten nicht
ersichtlich; für die Monate Juli und August 2022 ist
demgegenüber wieder von einer gerichtlichen Aktivität
auszugehen. Die Klägerin gesteht dem neuen Berichterstatter
eine Einarbeitungszeit zu, die sie mit zwei Monaten (Juni/Juli
2022) veranschlagt, bis dieser schließlich mit Beschluss vom
01.08.2022 über die Erinnerung entschied und den
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25.01.2017 zugunsten der
Klägerin abänderte. Der Senat erachtet indes den Juni
2022 ebenfalls für verzögert. Eine generelle
Einarbeitungszeit für den neuen Berichterstatter ist
entschädigungsrechtlich nicht anzusetzen (s. oben unter ee).
Allerdings versteht es sich, dass die Fertigung des
schließlich am 01.08.2022 ergangenen Beschlusses im Juli 2022
begonnen haben muss, so dass dieser Monat nicht als verzögert
anzusehen ist.
|
|
|
|
|
75
|
4. Über den Entschädigungsanspruch
im Umfang von 35 Monaten (3.500 EUR) hinaus, den der Beklagte
bereits anerkannt hat, steht der Klägerin für die
restliche Dauer der Verzögerung lediglich im Umfang von
weiteren zehn Monaten eine Geldentschädigung in Höhe von
weiteren 1.000 EUR zu; das darüber hinausgehende
Entschädigungsbegehren (600 EUR) ist daher
unbegründet.
|
|
|
|
|
76
|
a) Das Bestehen eines
Nichtvermögensnachteils wird in Fällen unangemessener
Verfahrensdauer gemäß § 198 Abs. 2 Satz 1 GVG
vermutet (vgl. auch Senatsurteil vom 29.11.2017 - X K 1/16, BFHE
259, 499, BStBl II 2018, 132 = SIS 17 24 19, Rz 35). Umstände,
die die gesetzliche Vermutung widerlegten (vgl. Senatsurteil vom
23.03.2022 - X K 6/20, BFHE 276, 308, BStBl II 2022, 811 = SIS 22 14 63, Rz 38, m.w.N.), sind vom Beklagten nicht vorgetragen worden
und auch nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass es sich bei
der Klägerin um eine Kapitalgesellschaft handelt,
entkräftet die Vermutungswirkung des § 198 Abs. 2 Satz 1
GVG nicht. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist
geklärt, dass ein Entschädigungsanspruch wegen
immaterieller Nachteile infolge unangemessener Dauer eines
Gerichtsverfahrens auch einer juristischen Person des Privatrechts
zustehen kann (vgl. BSG-Urteil vom 12.02.2015 - B 10 ÜG 1/13
R, BSGE 118, 91, Rz 34 ff.; Senatsurteil vom 29.11.2017 - X K 1/16,
BFHE 259, 499, BStBl II 2018, 132 = SIS 17 24 19, Rz 37).
|
|
|
|
|
77
|
b) Für die Kompensation des erlittenen
Nachteils ist im Streitfall eine Wiedergutmachung auf andere Weise
statt der Zuerkennung einer Geldentschädigung nicht
ausreichend.
|
|
|
|
|
78
|
aa) Nach § 198 Abs. 2 Satz 2 GVG kann
für einen Nichtvermögensnachteil eine
(Geld-)Entschädigung nur beansprucht werden, soweit nicht nach
den Umständen des Einzelfalls Wiedergutmachung auf andere
Weise gemäß § 198 Abs. 4 GVG ausreichend ist.
|
|
|
|
|
79
|
(1) Nach der Rechtsprechung des Senats
begründet der Gesetzeswortlaut keinen Vorrang der
Geldentschädigung vor einem Feststellungsausspruch, so dass
vor der Zuerkennung einer Geldentschädigung jeweils konkret zu
prüfen ist, ob die bloße Feststellung einer
unangemessenen Verfahrensdauer als Wiedergutmachung ausreichend
ist. Dies kann nicht pauschal, sondern muss unter Abwägung
aller Belange im Einzelfall entschieden werden (vgl. zum Ganzen
Senatsurteile vom 23.03.2022 - X K 6/20, BFHE 276, 308, BStBl II
2022, 811 = SIS 22 14 63, Rz 42, m.w.N. und vom 06.11.2024 - X K
1/24 = SIS 25 05 48, seit dem 17.04.2025 abrufbar unter
www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online,
unter II.9.a, c).
|
|
|
|
|
80
|
(2) In der Rechtspraxis hat sich gleichwohl
gezeigt, dass die Zuerkennung einer Geldentschädigung die
Regel, die Wiedergutmachung auf andere Weise eine typischerweise in
bestimmten Fallgruppen (dazu noch unten cc) auftretende Ausnahme
ist.
|
|
|
|
|
81
|
Die Rechtsprechung des BSG stimmt damit in
ihren Ergebnissen überein, betont aber schon seit jeher
ausdrücklich, dass die Kompensation eines
Nichtvermögensschadens auf andere Weise als durch eine
Geldentschädigung nur ausnahmsweise in Betracht komme (so
bereits BSG-Urteil vom 21.02.2013 - B 10 ÜG 1/12 KL, BSGE 113,
75, Rz 45, unter ausführlicher Analyse der Rechtsprechung des
EGMR, der ebenfalls im Regelfall Geldentschädigungen zuerkenne
und nur ausnahmsweise einen bloßen Feststellungsausspruch
tätige; ferner z.B. BSG-Urteile vom 03.09.2014 - B 10 ÜG
12/13 R, SozR 4-1720 § 198 Nr. 4, Rz 59; vom 12.02.2015 - B 10
ÜG 11/13 R, BSGE 118, 102, Rz 36 und vom 26.10.2023 - B 10
ÜG 1/22 R, NJW 2024, 1683, Rz 23). Dem schließt sich der
Senat an, wobei - auch nach Auffassung des BSG - weiterhin eine
Betrachtung der Umstände des Einzelfalls erforderlich ist (s.
dazu unten cc).
|
|
|
|
|
82
|
bb) Die häufigste dieser Fallgruppen ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangsverfahren für den
Beteiligten objektiv keine besondere Bedeutung hatte. Ferner wird
eine Geldentschädigung versagt, wenn der Beteiligte aufgrund
der unangemessenen Verfahrensdauer in den Genuss eines
ausgleichenden Vorteils gekommen ist. Schließlich können
Besonderheiten im eigenen Verhalten des Beteiligten die
Geldentschädigung ausschließen, soweit diese
Besonderheiten nicht schon dazu führen, dass bereits
gemäß § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG die Unangemessenheit
der Verfahrensdauer als solche zu verneinen wäre.
Geldentschädigung ist allerdings nicht schon deshalb
abzulehnen, weil der Verfahrensbeteiligte neben der
Überlänge des Verfahrens keinen weitergehenden
immateriellen Nachteil erlitten hat (vgl. im Einzelnen
Senatsurteile vom 23.03.2022 - X K 6/20, BFHE 276, 308, BStBl II
2022, 811 = SIS 22 14 63, Rz 47, und vom 06.11.2024 - X K 1/24 =
SIS 25 05 48, seit dem 17.04.2025 abrufbar unter
www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online,
unter II.9.b, m.w.N.).
|
|
|
|
|
83
|
cc) Ungeachtet dieser Typisierung hält der Senat
jedoch mit dem BSG weiterhin eine Betrachtung der Umstände des
Einzelfalls für erforderlich. Die beschriebenen Fallgruppen
begründen keine Vermutungswirkung (wie bei § 198 Abs. 2
Satz 1 GVG); jedoch kommt den tatsächlichen Umständen die
ihnen zugrunde liegen, eine indizielle Bedeutung zu. Die
Fallgruppen sind auch nicht abschließend. Es bleibt erforderlich, eine
Abwägung aller Belange im Einzelfall vorzunehmen (s. oben
B.II.4.a aa(1)).
|
|
|
|
|
84
|
In diese Abwägung ist regelmäßig
einzustellen, ob das Ausgangsverfahren für den
Entschädigungskläger eine besondere Bedeutung hatte.
Darüber hinaus kann aber auch bedeutsam sein, ob der
Entschädigungskläger durch sein Prozessverhalten
erheblich zur Verzögerung des Ausgangsverfahrens beigetragen
hat, ob er weitergehende immaterielle Schäden erlitten hat
oder ob die Überlänge den einzigen Nachteil darstellt.
Schließlich kann im Rahmen des Abwägungsvorgangs vom
Entschädigungsgericht zu berücksichtigen sein, von
welchem Ausmaß die Unangemessenheit der Dauer des Verfahrens
ist und ob das Ausgangsverfahren für den Verfahrensbeteiligten
eine besondere Dringlichkeit aufwies oder ob diese zwischenzeitlich
entfallen war oder ob sich das Ausgangsgericht in besonderem
Maße unkooperativ oder uneinsichtig verhalten hat (vgl.
BSG-Beschluss vom 11.11.2019 - B 10 ÜG 1/19 B, juris, Rz 8,
m.w.N. aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung).
|
|
|
|
|
85
|
dd) Für verzögerte
Kostenfestsetzungsverfahren hat es die Rechtsprechung insbesondere
mit Rücksicht auf die fehlende Bedeutung des Verfahrens, aber
auch unter dem Aspekt des Vorteilsausgleichs, in einer Reihe von
Einzelfällen abgelehnt, Geldentschädigung
zuzusprechen.
|
|
|
|
|
86
|
(1) Das BVerfG hat einen bloßen
Feststellungsausspruch wegen objektiv fehlender besonderer
Bedeutung des Verfahrens als Wiedergutmachung ausreichen lassen,
als ein Rechtsanwalt in eigener Sache ein
Kostenfestsetzungsverfahren geführt hatte. Ein solches
Verfahren sei für die Partei im Verhältnis zum
Hauptsacheverfahren regelmäßig nur von untergeordneter
Bedeutung. Materiell sei die Verfahrensdauer in gewisser Weise
sogar günstig, da der Kostenerstattungsanspruch verzinst
werde. Dem Grunde nach stehe der Kostenerstattungsanspruch durch
die Kostengrundentscheidung bereits fest, und bei einem
Rechtsanwalt, der die Wirkungszusammenhänge gerichtlicher
Verfahren einschätzen könne, bestehe ein immaterieller
Nachteil in weitaus geringerem Maße als bei einem Laien
(BVerfG-Beschluss vom 11.12.2023 - 2 BvR 739/17 - Vz 5/23, NJW
2024, 1331, Rz 77).
|
|
|
|
|
87
|
Die Überlegung, der
Kostenerstattungsanspruch werde verzinst, entspringt dem im
Entschädigungsrecht allgemein anerkannten Prinzip des
Vorteilsausgleichs, das auch im Rahmen der §§ 198 ff. GVG
Anwendung findet und aufgrund dessen in den Abwägungsvorgang
die von dem Beteiligten durch die Verfahrensdauer erlangten
finanziellen Vorteile einzubeziehen sind (vgl. BVerwG-Urteil vom
12.07.2018 - 2 WA 1.17 D, NJW 2019, 320, Rz 36). Auf diesem
Grundsatz beruht die zweite Fallgruppe (s. oben B.II.4.b bb).
|
|
|
|
|
88
|
(2) Vor allem mit Rücksicht auf die
fehlende Bedeutung der Sache vertritt das BSG die Auffassung, ein
Kostenfestsetzungs- und
Erinnerungsverfahren sei nach Erledigung des vorangegangenen
Hauptsacheverfahrens für dessen Beteiligte im Allgemeinen von
untergeordneter Bedeutung. Im Mittelpunkt dürften
finanzielle Interessen des Prozessbevollmächtigten stehen, der
nicht Beteiligter des Kostenfestsetzungsverfahrens sei (vgl.
BSG-Urteil vom 10.07.2014 - B 10 ÜG 8/13 R, SozR 4-1720 §
198 Nr. 2, Rz 31).
|
|
|
|
|
89
|
Die dieser Wertung folgenden
Landessozialgerichte stützen sich zudem jeweils auf weitere
Aspekte zur subjektiven Bedeutungslosigkeit (vgl. Urteil des
Hessischen LSG vom 01.08.2018 - L 6 SF 2/18 EK SB, ASR 2019, 123,
Rz 38: Gegenstand der Erinnerung Kopierkosten von 15,30 EUR; Urteil
des Bayerischen LSG vom 16.12.2015 - L 8 SF 128/12 EK, Das
Juristische Büro, 2016, 265, Rz 54: Keine Mitwirkung und
Selbstwiderspruch; Urteil des Sächsischen LSG vom 22.01.2018 -
L 11 SF 45/16 EK, juris, Rz 69: Gegenstand der Erinnerungen in vier
Ausgangsverfahren Kopier- und Portokosten von insgesamt 89,72 EUR
[52,62 EUR, 17,05 EUR, 13,55 EUR, 6,50 EUR]; Urteil des LSG
Berlin-Brandenburg vom 01.09.2022 - L 37 SF 131/21 EK SF, juris, Rz
26: Keine Kostenlast für den Beteiligten wegen PKH).
|
|
|
|
|
90
|
(3) Auch in anderen Gerichtszweigen werden als
Ausfluss des Prinzips des Vorteilsausgleichs die materiellen
Vorteile, die sich wegen der Verfahrensdauer aus der Verzinsung des
Kostenerstattungsanspruchs ab Eingang des Festsetzungsantrags in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
(§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO) ergeben, in den
Abwägungsvorgang einbezogen. Immaterielle Nachteile infolge
einer Verzögerung der Bearbeitung wögen im Vergleich dazu
eher gering (vgl. BVerwG-Urteil vom 12.07.2018 - 2 WA 1.17 D, NJW
2019, 320, Rz 36; Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom
27.05.2020 - 15 EK 3/19, MDR 2020, 1250, Rz 13).
|
|
|
|
|
91
|
ee) Aufgrund der insgesamt als
außergewöhnlich zu bezeichnenden Besonderheiten des
Streitfalls hält der Senat dennoch aufgrund der gebotenen
Abwägung im konkreten Einzelfall (s. oben unter B.II.4.b cc)
die Feststellung einer unangemessenen Verfahrensdauer zur
Wiedergutmachung nach § 198 Abs. 4 GVG für nicht
ausreichend und spricht der Klägerin eine weitere
Geldentschädigung im Umfang von 1.000 EUR zu.
|
|
|
|
|
92
|
Der Senat kann offenlassen, ob er sich der
Auffassung, einem Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahren
komme im Hinblick auf eine mögliche Verursachung immaterieller
Nachteile für den Verfahrensbeteiligten selbst
regelmäßig nur eine untergeordnete Bedeutung zu, mit der
Folge, dass als Wiedergutmachung lediglich die Überlänge
des Ausgangsverfahrens festgestellt wird, im Allgemeinen
anschließen könnte.
|
|
|
|
|
93
|
Jedenfalls vorliegend würde eine
bloße Feststellung den Gegebenheiten des Streitfalls nicht
gerecht, der sich durch eine besonders schwerwiegende
Verfahrensverzögerung auszeichnet. Dass der Fall hinsichtlich
seiner wirtschaftlichen Bedeutung nicht mit denjenigen verglichen
werden kann, über die die oben genannten Landessozialgerichte
zu entscheiden hatten (s. oben B.II.4.b dd (2)), bedarf keiner
weiteren Erläuterung.
|
|
|
|
|
94
|
Ausgehend von dem Kostenfestsetzungsantrag vom
15.01.2014 hat das Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahren bis
zu seinem Abschluss durch den Beschluss vom 01.08.2022 rund
achteinhalb Jahre gedauert, ohne dass der Klägerin
Versäumnisse bei der Mitwirkung anzulasten wären oder die
Kostenfestsetzung besondere Schwierigkeiten aufgewiesen hätte,
was auch vom Beklagten nicht vorgetragen wird. Die unangemessene
Dauer eines Gerichtsverfahrens als solche ist zwar im Ausgangspunkt
lediglich Voraussetzung des Entschädigungsanspruchs dem Grunde
nach. Allerdings nimmt mit der Dauer der Verzögerung auch das
Gewicht des zu entschädigenden Nachteils zu.
|
|
|
|
|
95
|
Letzterer wird nicht bereits durch die
materiellen Vorteile ausgeglichen, die der Klägerin dadurch
erwachsen sind, dass der Beschluss vom 01.08.2022 die Verzinsung
der zu erstattenden Kosten in Höhe von 159.739,86 EUR seit dem
15.01.2014 angeordnet hat. Im Streitfall sind - für ein
Gerichtsverfahren dieser Art - nicht allein extreme
Verfahrensverzögerungen festzustellen. Es kommt hinzu, dass
der frühere Berichterstatter auf die erstmals am 18.02.2019
erhobene Verzögerungsrüge, aber auch auf die
nachfolgenden Verzögerungsrügen während eines
Zeitraums von drei Jahren nicht sachlich nachvollziehbar reagierte
und der Klägerin keinen Zeitpunkt in Aussicht stellte, ab dem
mit einer Verfahrensförderung hätte gerechnet werden
können (vgl. Senatsurteil vom 19.03.2014 - X K 8/13, BFHE 244,
521, BStBl II 2014, 584 = SIS 14 15 45, Rz 35). Insoweit steht
vorliegend nicht nur das erkennbare Interesse des
Verfahrensbeteiligten an einer zügigen Entscheidung eines
Hauptsacheverfahrens in Rede, sondern vor allem das Interesse
daran, überhaupt irgendwann das Kostenfestsetzungs- und
Erinnerungsverfahren abschließen zu können.
|
|
|
|
|
96
|
Darüber hinaus war nicht nur der
Berichterstatter, sondern auch das Gericht institutionell aus Sicht
der Klägerin lange Zeit untätig geblieben. Sie hatte die
Gerichtsleitung mit Schreiben vom 02.08.2019 informiert. Dass die
Gerichtsleitung etwas unternommen hätte, ist nicht
aktenkundig. Jedenfalls haben trotz der ausbleibenden Reaktion des
Berichterstatters weder das Präsidium des FG noch der dort
zuständige Senat durch Änderung der gerichts- oder
senatsinternen Geschäftsverteilung etwas unternommen, damit
das Verfahren gegebenenfalls durch einen anderen Berichterstatter
erledigt werde. Erst zum 01.01.2022 fand ein Wechsel in der
Berichterstattung statt.
|
|
|
|
|
97
|
Unter diesen Umständen, die der
Klägerin den Eindruck vermitteln mussten, sie habe auf
unabsehbare Zeit jegliche Einwirkungsmöglichkeit zur
Beendigung ihres Gerichtsverfahrens verloren, erscheint die
Wiedergutmachung auch in Form einer Geldentschädigung
geboten.
|
|
|
|
|
98
|
Denn der bloßen Feststellung einer
überlangen Verfahrensdauer käme hier aufgrund der
besonderen Dauer und Hartnäckigkeit der Verweigerung des
Rechts auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 des
Grundgesetzes (GG) und des Justizgewährleistungsanspruchs aus
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. BVerwG-Urteil vom
11.07.2013 - 5 C 23.12 D, BVerwGE 147, 146, Rz 38) nicht die
gebotene Wirkung zu.
|
|
|
|
|
99
|
Bezweckt die Regelung des § 198 GVG einen
umfassenden und möglichst lückenlosen (zunächst
präventiven, notfalls kompensatorischen) Schutz gegen
überlange Gerichtsverfahren (vgl. BSG-Urteil vom 10.07.2014 -
B 10 ÜG 8/13 R, SozR 4-1720 § 198 Nr. 2, Rz 24), so liefe
der beabsichtigte Schutz nach Einschätzung des erkennenden
Senats letztlich ins Leere, wenn ein Ausgangsgericht selbst unter
Umständen wie den Vorliegenden allenfalls mit einem
Feststellungsausspruch, jedoch nicht damit rechnen müsste,
dass es wegen seiner Untätigkeit zu einer Verurteilung des
Landes oder Bundes (§ 200 GVG) zur Zahlung einer
Geldentschädigung kommt.
|
|
|
|
|
100
|
c) Dem Entschädigungsanspruch der
Klägerin für die Verzögerungszeiten vor dem
September 2018 bis zur Grenze des nicht streitgegenständlichen
Zeitraums des Kostenfestsetzungsverfahrens steht die im Regelfall
lediglich begrenzte Rückwirkung einer wirksamen
Verzögerungsrüge nicht entgegen.
|
|
|
|
|
101
|
aa) Voraussetzung für die Zuerkennung
einer Geldentschädigung ist gemäß § 198 Abs. 3
Satz 1 GVG die Erhebung einer Verzögerungsrüge. Diese
kann erst erhoben werden, wenn Anlass zur Besorgnis besteht, dass
das Verfahren nicht in einer angemessenen Zeit abgeschlossen wird
(§ 198 Abs. 3 Satz 2 GVG). Eine zu früh erhobene
Verzögerungsrüge ist daher unwirksam (vgl. nur
Senatsurteil vom 08.10.2019 - X K 1/19, BFH/NV 2020, 98 = SIS 19 18 91, Rz 59, m.w.N.). Dagegen wirkt eine erst deutlich nach
Überschreiten der Unangemessenheitsgrenze eingereichte
Verzögerungsrüge nicht ohne Weiteres bis auf den
Zeitpunkt zurück, ab dem die Verfahrensdauer bei objektiver
Betrachtung als unangemessen anzusehen ist. Vielmehr hat der Senat
auf Grundlage einer Gesamtschau der gesetzlichen Regelungen
über die Verzögerungsrüge entschieden, dass von
einer im Regelfall gut sechsmonatigen Rückwirkung auszugehen
ist, da einerseits Geduld nicht bestraft werden soll, andererseits
eine bewusst sehr spät im Sinne der unzulässigen Methode
„dulde und liquidiere“ eingelegte
Verzögerungsrüge keine präventive Wirkung mehr
entfalten kann (grundlegend Senatsurteil vom 06.04.2016 - X K 1/15,
BFHE 253, 205, BStBl II 2016, 694 = SIS 16 11 18, Rz 40 ff.; ebenso
Senatsurteil vom 25.10.2016 - X K 3/15, BFH/NV 2017, 159 = SIS 16 27 77, Rz 39, m.w.N.). Eine solche gut sechsmonatige
Rückwirkung ist jedoch nicht als starre Grenze zu verstehen,
sondern auch im Zusammenhang mit den weiteren Umständen des
jeweiligen Einzelfalls zu betrachten (vgl. Senatsurteil vom
23.03.2022 - X K 2/20, BFHE 275, 533, BStBl II 2023, 38 = SIS 22 12 71, Rz 46).
|
|
|
|
|
102
|
bb) Im Streitfall ist das Verhalten der
Klägerin bei Würdigung der Gesamtumstände nicht als
Ausdruck eines unzulässigen „Duldens und
Liquidierens“ zu verstehen. Es liegt insoweit
ein Ausnahmefall vor, als der Senat für den Bereich der
Finanzgerichtsbarkeit bislang noch keine
entschädigungsrechtliche Entscheidung zu der in Rede stehenden
Verfahrensart getroffen hat, an der sich die Klägerin im
Hinblick auf den Zeitpunkt der zu besorgenden Unangemessenheit der
Verfahrensdauer und damit der Einlegung einer
Verzögerungsrüge hätte orientieren können.
|
|
|
|
|
103
|
Die Klägerin ging in der damaligen Zeit
augenscheinlich rechtsirrig davon aus, dass auf das
Erinnerungsverfahren die vom Senat für das Klageverfahren
aufgestellten Grundsätze auch vorliegend anwendbar seien,
namentlich, dass die Verfahrensdauer noch angemessen ist, wenn das
Gericht gut zwei Jahre nach Verfahrenseinleitung mit
Maßnahmen beginnt, die das Verfahren einer Entscheidung
zuführen sollen. Dafür spricht, dass sie die
Verzögerungsrüge am 18.02.2019 und somit ungefähr
zwei Jahre nach dem Kostenfestsetzungsbeschluss der Urkundsbeamtin
beziehungsweise der Einlegung der Erinnerung erhob.
|
|
|
|
|
104
|
Vor dem Hintergrund, dass es seinerzeit noch
keine Entscheidung in Bezug auf eine Typisierung der im Regelfall
als angemessen anzusehenden Dauer eines Erinnerungsverfahrens gab,
erscheint es im Streitfall sachgerecht, den vom Senat ansonsten
betonten Präventivgedanken (vgl. Senatsurteil vom 06.04.2016 -
X K 1/15, BFHE 253, 205, BStBl II 2016, 694 = SIS 16 11 18, Rz 44)
hier zurückzunehmen und der Verzögerungsrüge der
Klägerin ausnahmsweise eine über den typisierten
Regelzeitraum von sechs Monaten hinausgehende Rückwirkung
beizumessen.
|
|
|
|
|
105
|
d) Entgegen der Auffassung der Klägerin
bestehen im Streitfall keine Gründe, vom gesetzlichen
Regelbetrag der Entschädigung nach oben abzuweichen.
|
|
|
|
|
106
|
aa) Die Geldentschädigung beträgt
grundsätzlich 1.200 EUR für jedes Jahr der
Verzögerung (§ 198 Abs. 2 Satz 3 GVG), wobei dieser
Betrag zeitanteilig nach Monaten bemessen werden kann (Senatsurteil
vom 20.08.2014 - X K 9/13, BFHE 247, 1, BStBl II 2015, 33 = SIS 14 25 64, Rz 38). Ist der genannte Betrag nach den Umständen des
Einzelfalls unbillig, kann das Gericht einen höheren oder
niedrigeren Betrag festsetzen (§ 198 Abs. 2 Satz 4 GVG).
|
|
|
|
|
107
|
bb) Der erkennende Senat hat in seiner
bisherigen Rechtsprechung von der Billigkeitsregelung des §
198 Abs. 2 Satz 4 GVG noch keinen Gebrauch gemacht und
dementsprechend keine abstrakten Maßstäbe hierzu
entwickelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
ist das Entschädigungsgericht im Hinblick auf den
Vereinfachungszweck der Pauschalierung nur beim Vorliegen
besonderer Umstände gehalten, aus Billigkeitsgründen von
dem normierten Pauschalsatz abzuweichen (BGH-Urteil vom 14.11.2013
- III ZR 376/12, BGHZ 199, 87, Rz 46), etwa durch Erhöhung
für die besondere Bedeutung eines Pilotverfahrens bei
gleichzeitigem Fortfall der Entschädigung für die
Folgeverfahren (BGH-Urteile vom 15.12.2022 - III ZR 192/21, BGHZ
236, 10 und vom 09.03.2023 - III ZR 80/22, BGHZ 236, 246) oder
aufgrund schwerwiegender Beeinträchtigungen aufgrund der
Verzögerung (BGH-Urteil vom 06.05.2021 - III ZR 72/20, BGHZ
230, 14).
|
|
|
|
|
108
|
cc) Solche besonderen Umstände sind
vorliegend nicht ersichtlich. Die Klägerin beruft sich zwar
darauf, dass die Festsetzung einer höheren monatlichen
Entschädigung wegen Unbilligkeit nach § 198 Abs. 2 Satz 4
GVG angesichts der eklatanten Verletzung des Anspruchs auf
zeitnahen Rechtsschutz in Betracht komme. Mit diesem Vorbringen
kann im Streitfall aber noch keine auf Billigkeitsgründe
gestützte Abweichung vom gesetzlichen Regelbetrag der
Entschädigung begründet werden. Erachtet der Gesetzgeber
die gesetzlich vorgesehene Entschädigungshöhe für
das im Grundsatz bedeutsamere Hauptsacheverfahren für
angemessen, so gilt dies erst recht für das hier in Rede
stehende Nebenverfahren. Dem Umstand, dass das Kostenfestsetzungs-
und Erinnerungsverfahren bis zu seiner Erledigung rund achteinhalb
Jahre angedauert hat, hätte die Klägerin - was die
begehrte Gesamtentschädigung anbelangt - durch die
Nichtbegrenzung des Streitgegenstandes und Einbeziehung des
Kostenfestsetzungsverfahrens Rechnung tragen können.
|
|
|
|
|
109
|
5. Der Zinsausspruch folgt aus § 291
i.V.m. § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB (vgl. Senatsurteil vom
19.03.2014 - X K 8/13, BFHE 244, 521, BStBl II 2014, 584 = SIS 14 15 45, Rz 39 f.).
|
|
|
|
|
110
|
6. Die Kostenentscheidung beruht auf §
136 Abs. 1 Satz 1 und § 138 Abs. 1 FGO i.V.m. § 155 Satz
2 FGO. Der Senat entscheidet über die Kosten nach
Verfahrensabschnitten.
|
|
|
|
|
111
|
Bis zu den übereinstimmenden
Erklärungen der Beteiligten zur Erledigung des Rechtsstreits
in der Hauptsache in Höhe von 3.500 EUR hatte die
Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 5.100 EUR
begehrt; über den vom Beklagten anerkannten Betrag hinaus ist
die Klage in Höhe von weiteren 1.000 EUR begründet.
Hinsichtlich des Teilbetrags von 1.600 EUR, der Gegenstand der
vorliegenden Entscheidung ist, folgt die Kostenentscheidung aus
§ 136 Abs. 1 Satz 1 FGO. Insoweit hat die Klägerin zu
einem Anteil von 1.000 EUR obsiegt. Hinsichtlich des vom Beklagten
anerkannten Teilbetrags von 3.500 EUR folgt sie aus § 138 Abs.
1 FGO. Nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO fielen der
Klägerin die Prozesskosten nur zur Last, wenn der Beklagte den
Anspruch „sofort“ anerkannt hätte,
das heißt, jedenfalls innerhalb der ihm gesetzten
(verlängerten) Klageerwiderungsfrist bis zum 02.05.2023 das
Teilanerkenntnis in Höhe von 3.500 EUR abgegeben hätte.
Er hat es aber erst mit Schriftsatz vom 07.09.2023 ausgesprochen
(vgl. Senatsurteil vom 29.11.2017 - X K 1/16, BFHE 259, 499, BStBl
II 2018, 132 = SIS 17 24 19, Rz 53 ff.).
|
|
|
|
|
112
|
Daraus ergibt sich bis zum 11.03.2024 - dem
Zeitpunkt der letzten Erledigungserklärung - eine
Obsiegensquote der Klägerin von 88 % (4.500 EUR von 5.100
EUR).
|
|
|
|
|
113
|
Ab dem 12.03.2024 war der
Entschädigungsanspruch lediglich noch im Umfang von 1.600 EUR
streitig. Aufgrund der Zuerkennung einer Entschädigung in
Höhe von 1.000 EUR ergibt sich eine Obsiegensquote der
Klägerin von 63 %.
|
|
|
|
|
114
|
Hieraus errechnen sich die tenorierten
Prozentsätze.
|