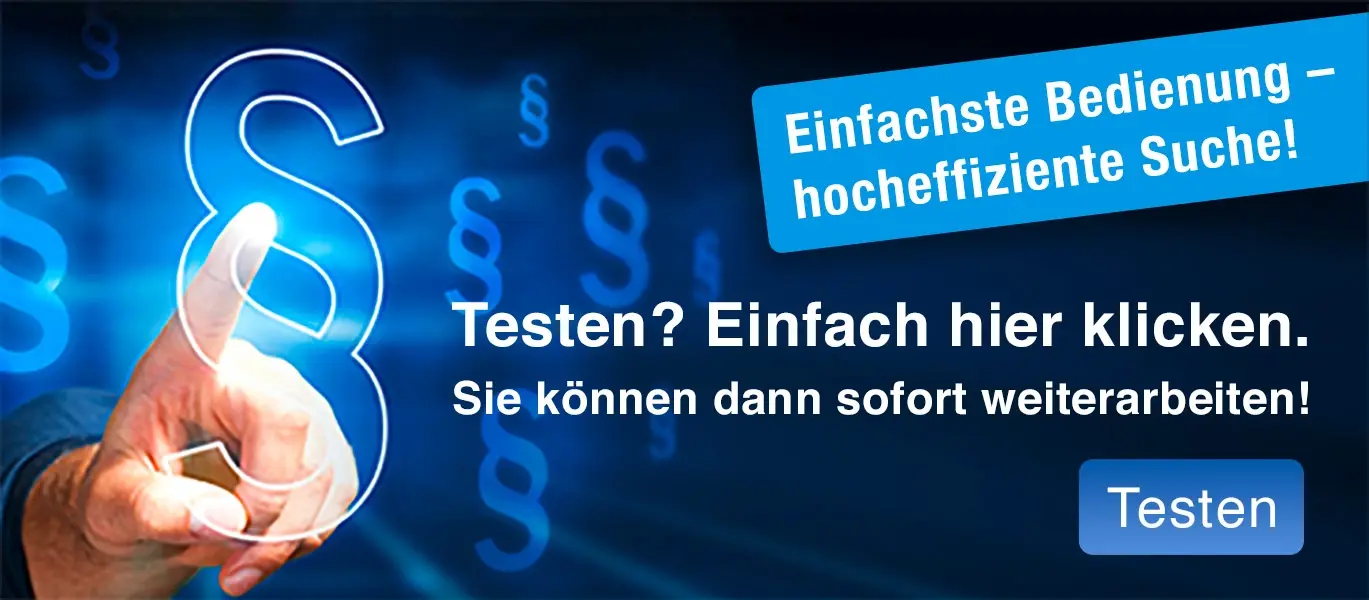
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Erste Tätigkeitsstätte einer Flugzeugführerin nach neuem Reisekostenrecht
Erste Tätigkeitsstätte einer Flugzeugführerin nach neuem Reisekostenrecht: 1. Ortsfeste betriebliche Einrichtungen sind räumlich zusammengefasste Sachmittel, die der Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen und mit dem Erdboden verbunden oder dazu bestimmt sind, überwiegend standortgebunden genutzt zu werden. - 2. Eine (großräumige) erste Tätigkeitsstätte liegt auch vor, wenn eine Vielzahl solcher Mittel, die für sich betrachtet selbständige betriebliche Einrichtungen darstellen können, räumlich abgrenzbar in einem organisatorischen, technischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten stehen. Demgemäß kommt als eine solche erste Tätigkeitsstätte auch ein großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet (z.B. Werksanlage, Betriebsgelände, Bahnhof oder Flughafen) in Betracht. - 3. Eine Flugzeugführerin, die von ihrem Arbeitgeber arbeitsrechtlich einem Flughafen dauerhaft zugeordnet ist und auf dem Flughafengelände zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten erbringt, die sie als Flugzeugführerin arbeitsvertraglich schuldet, hat dort ihre erste Tätigkeitsstätte. - 4. Die Zuordnung zu einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie diese ausfüllenden Absprachen bestimmt. Einer gesonderten Zuordnung für einkommensteuerliche Zwecke bedarf es nicht. - Urt.; BFH 11.4.2019, VI R 40/16; SIS 19 09 78
Lohnsteuer für Arbeitnehmer > Dienstreisen, Dienstgänge
-
BFH 11.04.2019, VI R 40/16 (ECLI:DE:BFH:2019:U.110419.VIR40.16.0)
BStBl 2019 II S. 546
DStR 2019 S. 1510
Anmerkungen:
zur Veröffentlichung in BStBl II bestimmt nach BMF-Online vom 28.8.2019
S. Geserich in BFH/PR 10/2019 S. 240
J.H. in StuB 15/2019 S. 602
B. Rätke in BBK 16/2019 S. 765
[EStG] § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, § 9 Abs. 4, § 9 Abs. 4 a
- vor: FG Hamburg, 13.10.2016, SIS 16 27 05, Erste Tätigkeitsstätte, Flugzeugführer, Flughafen, Zuordnung
- FG Berlin-Brandenburg 18.9.2025, SIS 25 15 93, Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer angestellten Stewardess: Ist eine angestellte Flugbegleiterin ...
- BFH 17.6.2025, SIS 25 13 76, Keine erste Tätigkeitsstätte eines Leiharbeitnehmers beim Entleiher im Rahmen eines unbefristeten Leiharb...
- FG Bremen 3.4.2025, SIS 25 07 28, Containerterminal in Bremerhaven als erste Tätigkeitsstätte für einen Hafenarbeiter mit Schwerpunkt auf G...
- FG Berlin-Brandenburg 25.2.2025, SIS 25 11 08, Werbungskostenabzug für nur am Wochenanfang und am Wochenende von einem Berufskraftfahrer zum Betriebssit...
- FG Bremen 6.2.2025, SIS 25 09 43, Autoterminalgelände im Hafen Bremerhaven als erste Tätigkeitsstätte für einen als Fahrpersonal im Autoums...
- FG Köln 4.12.2024, SIS 25 06 11, Abgrenzung von Dienstreisen zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei einem Piloten: 1....
- Niedersächsisches FG 18.6.2024, SIS 25 07 76, Höhe der Abziehbarkeit von Fahrtkosten eines Leiharbeitnehmers für Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsste...
- FG Nürnberg 6.12.2023, SIS 24 04 51, Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte eines Flugzeugführers mit wechselnden Einsatzorten: Ein Flugzeugfü...
- BFH 14.9.2023, SIS 23 17 99, Zur Feststellung der Zuordnung des Arbeitnehmers im steuerlichen Reisekostenrecht: Eine (stillschweigende...
- FG München 21.3.2023, SIS 24 06 72, Erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitnehmern: 1. "Ortsfeste betriebliche Einrichtungen" im Sinne des § 9 ...
- FG Nürnberg 8.3.2023, SIS 23 09 56, Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen und Fahrtkosten einer Soldatin auf Zeit zur Bildungsstä...
- FG Hamburg 24.11.2022, SIS 23 04 33, Einkommensteuer, erste Tätigkeitsstätte bei fliegendem Personal: 1. Erforderlich, aber auch ausreichend i...
- BFH 22.11.2022, SIS 23 03 63, Erste Tätigkeitsstätte eines Zeitsoldaten: Ein Zeitsoldat kann an dem Bundeswehrstandort, dem er dauerhaf...
- BFH 26.10.2022, SIS 23 03 07, Erste Tätigkeitsstätte bei Ableistung von Arbeitsbereitschafts- und Bereitschaftsruhezeiten: Die Ableistu...
- LfSt Rheinland-Pfalz 14.10.2022, SIS 22 18 42, Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirte für das Kalenderjahr 2020 sowie aktuelle Hinweise zum Vera...
- Niedersächsisches FG 2.9.2022, SIS 23 03 31, Berücksichtigen von Verpflegungsmehraufwendungen eines Hafenarbeiters hinsichtlich Zuordnung einer ersten...
- Niedersächsisches FG 2.9.2022, SIS 23 19 14, Hafengebiet als erste Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG: Die Feststellungslast für das Vor...
- FG Mecklenburg-Vorpommern 1.9.2022, SIS 22 21 03, Berücksichtigung der Fahrten eines angestellten Möbelmonteurs zu einem an einem Sammelpunkt auf öffentlic...
- Niedersächsisches FG 14.6.2022, SIS 22 20 53, Ort der ersten Tätigkeitsstätte bei Versetzung und sofortiger mehrjähriger Rückabordnung eines Finanzbeam...
- BFH 12.5.2022, SIS 22 17 09, Keine dauerhafte Zuordnung bei nur befristeten Einsätzen im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses: 1. Im ...
- FG Mecklenburg-Vorpommern 24.11.2021, SIS 22 01 32, Erste Tätigkeitsstätte sowie Verpflegungsmehraufwand eines angestellten Bauleiters: 1. Wird eine Niederla...
- FinMin Schleswig-Holstein 18.10.2021, SIS 21 21 63, Verpflegungsmehraufwendungen bei Tätigkeiten von Landwirten auf den zur Hofstelle zugehörigen Betriebsflä...
- BFH 2.9.2021, SIS 21 18 56, Typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber festgelegten Sammelpunkts: 1. Die entspre...
- Niedersächsisches FG 13.7.2021, SIS 21 19 19, Erste Tätigkeitsstätte bei einem Leiharbeitnehmer: 1. Bei einem Leiharbeitnehmer, der unbefristet bei ein...
- BFH 12.7.2021, SIS 21 17 79, Erste Tätigkeitsstätte einer Mitarbeiterin des allgemeinen Ordnungsdienstes nach neuem Reisekostenrecht: ...
- Hessisches FG 26.4.2021, SIS 22 02 90, Flughafen als erste Tätigkeitsstätte eines Piloten und einer Flugbegleiterin gem. § 9 Abs. 4 EStG, Unzulä...
- FG Rheinland-Pfalz 18.3.2021, SIS 21 07 10, Steuerbarkeit der Probandenhonorare für Teilnahme an medizinische Studien: 1. Die Teilnahme an einer mehr...
- Niedersächsisches FG 3.2.2021, SIS 21 07 00, Hafengebiet als weiträumiges Tätigkeitsgebiet i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 a EStG: Für einen Hafenarb...
- FG Rheinland-Pfalz 17.12.2020, SIS 21 07 06, Erste Tätigkeitsstätte eines Zeitsoldaten der Bundeswehr: Wird ein Zeitsoldat durch eine Versetzungsverfü...
- BFH 17.12.2020, SIS 21 06 68, Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung nach neuem Reisekostenrecht: Erst...
- BFH 17.12.2020, SIS 21 06 69, Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung nach neuem Reisekostenrecht: Erst...
- BFH 17.12.2020, SIS 21 06 77, Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung nach neuem Reisekostenrecht: Erst...
- BFH 16.12.2020, SIS 21 07 71, Erste Tätigkeitsstätte eines Gerichtsvollziehers: 1. Eine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers i.S. ...
- BMF 25.11.2020, SIS 20 19 29, Steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern: Das Bundesfinanzministerium hat ein neues Schre...
- BFH 30.9.2020, SIS 20 21 21, Erste Tätigkeitsstätte eines Postzustellers nach neuem Reisekostenrecht: Der Zustellpunkt (Zustellzentrum...
- BFH 30.9.2020, SIS 20 21 35, Erste Tätigkeitsstätte eines Postzustellers nach neuem Reisekostenrecht: Der Zustellpunkt (Zustellzentrum...
- BFH 30.9.2020, SIS 20 21 36, Erste Tätigkeitsstätte eines Rettungsassistenten nach neuem Reisekostenrecht: Die Rettungswache, der ein ...
- Niedersächsisches FG 23.7.2020, SIS 20 16 23, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit bei einem sog. Gesamthafenarbeiter im Hamburger Hafen: Die Fahrten ei...
- Niedersächsisches FG 28.5.2020, SIS 20 13 78, Entfernungspauschale oder Reisekosten bei Fahrten von Zeitarbeitern zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte...
- BFH 12.2.2020, SIS 20 06 60, Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen: Die Entfernun...
- FG Rheinland-Pfalz 28.11.2019, SIS 19 22 62, Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen, erste Tätigkeitsstätte bei einem Feuerwehrmann: Bei einem F...
- FG Hamburg 24.10.2019, SIS 19 20 68, Berücksichtigung von Werbungskosten für eine Zweitwohnung, die für Übernachtungen im Rahmen einer wechsel...
- BFH 10.4.2019, SIS 19 10 21, Erste Tätigkeitsstätte des fliegenden Personals nach neuem Reisekostenrecht: 1. Fliegendes Personal, das ...
- LIT 03 91 35 S. Geserich, NWB 40/2019 S. 2925: BFH bestätigt neues Reisekostenrecht - Lit.; S. Geserich, NWB 40/2019 S. 2925; EStG 3 9 Abs. 4 S. 1; BFH ...
- LIT 03 91 52 R. Krüger, DB 39/2019 S. 2143: Erste BFH-Rspr. zum neuen Reisekostenrecht - Lit.; R. Krüger, DB 39/2019 S. 2143; EStG § 9 Abs. 4 S. 1; B...
Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 13.10.2016 - 6 K 20/16 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
|
1 |
I. Streitig ist, ob Aufwendungen für Fahrten einer Flugzeugführerin von und zu ihrem Heimatflughafen (home base) unter der Geltung des neuen Reisekostenrechts nach Dienstreisegrundsätzen oder nach Maßgabe der Entfernungspauschale als Werbungskosten sowie Mehraufwendungen für Verpflegung anzusetzen sind. |
|
|
|
|
2 |
Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist seit September 2007 als Flugzeugführerin bei der A angestellt. Sie war zunächst bei „X/0/0“ in X, später in Y beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war vereinbart, dass die A die Klägerin auch auf anderen Flugzeugmustern, an anderen Orten sowie vorübergehend bei anderen Unternehmen im Konzern einsetzen konnte (Tz. 1 Abs. 2). |
|
|
|
|
3 |
Mit Schreiben vom November 2011 versetzte die A die Klägerin aufgrund ihrer Umschulung auf den A340 ab Dezember 2011 vom Flughafen Y (Y/0/0) zum Flughafen X (X/0/1). Im Versetzungsschreiben behielt sich die A - wie schon im Anstellungsvertrag - vor, die Klägerin auf anderen Flugzeugmustern, an anderen Orten sowie vorübergehend bei anderen Unternehmen im A Konzern einzusetzen. Nach dem Streitjahr (2014) wurde die Klägerin auf ihren Antrag hin wieder nach Y versetzt. |
|
|
|
|
4 |
Im Operations Manual Part A (OM-A) der A ist Folgendes bestimmt (Kapitel 7, Revision 36): |
|
|
|
|
|
7.DE.100 Geltungsbereich |
|
|
Im OM-A Kapitel 7 sind die Anforderungen an A als Betreiber gewerblichen Luftverkehrs und deren Besatzungsmitglieder in Bezug auf Flug- und Dienstzeitbeschränkungen und Ruhevorschriften für Besatzungsmitglieder festgelegt. Dieses OM-A Kapitel 7 ist der gesetzlich geforderte und behördlich genehmigte Flugzeitspezifikationsplan der A, der allen geltenden Rechtsvorschriften entspricht. (...) |
|
|
|
|
|
7.DE.105 Begriffsbestimmungen |
|
|
(...) |
|
|
14. „Heimatbasis“ (home base): der von A gegenüber dem Besatzungsmitglied benannte Ort, wo das Besatzungsmitglied normalerweise eine Dienstzeit oder eine Abfolge von Dienstzeiten beginnt und beendet und wo A normalerweise nicht für die Unterbringung des betreffenden Besatzungsmitglieds verantwortlich ist; (...). |
|
|
|
|
|
7.DE.200 Heimatbasis |
|
|
(a) Die Heimatbasis ist ein einzelner Flughafenstandort, der mit einem hohen Grad an Beständigkeit zugewiesen ist. |
|
|
A weist die Heimatbasis individuell im Arbeitsvertrag zu. (...) |
|
|
|
|
5 |
Ferner sind unter 7.DE.205.a OM-A - in Abhängigkeit vom Flugzeugtyp und vom Abflughafen - die Zeiten für das vor jedem Flug erforderliche Briefing festgelegt, die zwischen 60 und 100 Minuten betragen. Nach Kapitel 14 Ziffer 14.3.1.1 OM-A muss jedes Besatzungsmitglied über einen dienstlichen Wohnsitz im Einzugsbereich seines Einsatzorts verfügen, von dem aus der Flugdienst während des Bereitschaftsdiensts innerhalb von 60 Minuten nach Benachrichtigung angetreten werden kann. Für die Beförderung zum und vom Dienst am Einsatzort ist nach Kapitel 14 Ziffer 14.3.3.1 OM-A das einzelne Besatzungsmitglied verantwortlich. Als Dienstreisen gelten dementsprechend Reisen im dienstlichen Auftrag außerhalb des üblichen Streckeneinsatzes, z.B. die Anreise zum Simulator oder Public Relations Assignments (14.4.1.1 OM-A). Kosten hierfür trägt die A (14.4.1.3 OM-A). |
|
|
|
|
6 |
Im Streitjahr war die Klägerin als First Officer (Copilotin) tätig und ausschließlich im internationalen Flugverkehr eingesetzt. Sie hatte insgesamt 24 Einsätze bei 139 Arbeitstagen, darunter fünf Bereitschaftsdienste, einen Bürodienst, einen Simulatorcheck und eine medizinische Untersuchung. Sämtliche Flugeinsätze, die zwischen einem und sechs Tagen dauerten, begann und beendete die Klägerin am Flughafen X. Zu den dienstlichen Einsätzen reiste sie im Streitjahr an 39 Tagen mit dem Flugzeug oder mit ihrem eigenen PKW von ihrem Wohnort an und dorthin wieder ab. Bei einem frühen Dienstbeginn reiste sie am Vortag an und übernachtete in einem Hotel in X. Entsprechend verfuhr sie bei einem späten Dienstende und bei unmittelbar aufeinander folgenden Bereitschaftsdiensten und Schulungen. Von der A erhielt die Klägerin Abwesenheitsgeld für die Einsätze im Streckendienst, beginnend mit dem planmäßigen Abflug und endend mit der in den flight-logs angegebenen Blockzeit (gemäß Tarifvertrag der A). |
|
|
|
|
7 |
Zu den Aufgaben der Klägerin als Copilotin gehörte es u.a., vor jedem Abflug an dem vorgeschriebenen Briefing der Flugbesatzung, das in sog. Briefingräumen der A am Flughafen X stattfand, teilzunehmen, die Wettermeldungen zu überprüfen, sich an der Beurteilung der Wetterlage zu beteiligen, alle notwendigen Unterlagen und Informationen zur Durchführung des Flugs einzuholen, den Flugplan zu überprüfen, sich mit dem technischen Status des Flugzeugs vertraut zu machen, dafür zu sorgen, dass alle Flugunterlagen vollständig an Bord verfügbar waren, die Abflugdaten zu errechnen und die an Bord befindliche Kraftstoffmenge mit der vorgeschriebenen Menge zu vergleichen. Nach dem Flug musste sie den Kommandanten bei der Vervollständigung der Flugunterlagen unterstützen und auf Anweisung schriftliche Berichte erstellen. |
|
|
|
|
8 |
Die A teilte dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt - FA - ) auf Anfrage mit, beim fliegenden Personal der A bestehe eine arbeitsrechtliche Zuordnung zu einem konkreten Flughafen (Stationierungsort), von wo der Mitarbeiter regelmäßig seinen Dienst beginne und beende. In Einzelfällen erfolgten abweichende Zuordnungen über Weisungen des Arbeitgebers, wobei der Stationierungsort im Versetzungsschreiben benannt sei, sodass auch in diesen Fällen eine eindeutige Zuordnung und damit eine erste Tätigkeitsstätte gegeben sei. Die Zuordnung ergebe sich somit aus den Dienstverträgen bzw. ergänzenden Versetzungsschreiben. |
|
|
|
|
9 |
In ihrer Einkommensteuererklärung machte die Klägerin u.a. Fahrtkosten von der Wohnung zum Flughafen X nach Dienstreisegrundsätzen sowie entsprechende Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten am Dienstort als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend. |
|
|
|
|
10 |
Im Rahmen der streitigen Einkommensteuerfestsetzung ließ das FA lediglich die Kosten für die Übernachtungen am Dienstort in tatsächlicher Höhe zum Werbungskostenabzug zu. Die geltend gemachten Fahrtkosten setzte es lediglich mit der Entfernungspauschale an. Mehraufwendungen für Verpflegung berücksichtigte das FA nicht. Die A habe der Klägerin den Flughafen X (im Arbeitsvertrag) als erste Tätigkeitsstätte zugewiesen. Daher könnten Verpflegungsmehraufwendungen für die An- und Abreisetage nicht und Aufwendungen für die Fahrten zwischen der Wohnung und dem Flughafen X nur in Höhe der Entfernungspauschale berücksichtigt werden. |
|
|
|
|
11 |
Die daraufhin erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in EFG 2017, 27 veröffentlichten Gründen ab. |
|
|
|
|
12 |
Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts. |
|
|
|
|
13 |
Sie beantragt, das Urteil des FG Hamburg vom 13.10.2016 - 6 K 20/16 sowie die Einspruchsentscheidung des FA vom 12.1.2016 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2014 vom 25.11.2015 dahingehend zu ändern, dass bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit weitere Werbungskosten in Höhe von 2.095,71 EUR berücksichtigt werden. |
|
|
|
|
14 |
Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen. |
|
|
|
|
15 |
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Rechtsstreit beigetreten. Einen Antrag hat es nicht gestellt. |
|
|
|
|
16 |
II. Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung - FGO - ). Das FG hat zutreffend entschieden, dass die Klägerin im Streitjahr am Flughafen X - ihrem Stationierungs- bzw. Heimatflughafen (home base) - ihre erste Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) hatte. Es hat deshalb zu Recht die Aufwendungen der Klägerin für die Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Flughafen X lediglich mit der Entfernungspauschale sowie die geltend gemachten weiteren Verpflegungsmehraufwendungen nicht zum Werbungskostenabzug zugelassen. |
|
|
|
|
17 |
1. Beruflich veranlasste Fahrtkosten sind Erwerbsaufwendungen. Handelt es sich bei den Aufwendungen des Arbeitnehmers um solche für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 EStG, ist zu deren Abgeltung für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, grundsätzlich eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 EUR anzusetzen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Sätze 1 und 2 EStG). |
|
|
|
|
18 |
2. Wird der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig (auswärtige berufliche Tätigkeit), ist gemäß § 9 Abs. 4a Satz 1 EStG zur Abgeltung der ihm tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen eine Verpflegungspauschale nach Maßgabe des Satzes 3 anzusetzen. |
|
|
|
|
19 |
3. Erste Tätigkeitsstätte ist nach der Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Der durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.2.2013 (BGBl I 2013, 285) neu eingeführte und in § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG definierte Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“ tritt an die Stelle des bisherigen unbestimmten Rechtsbegriffs der „regelmäßigen Arbeitsstätte“. |
|
|
|
|
20 |
a) Ortsfeste betriebliche Einrichtungen sind räumlich zusammengefasste Sachmittel, die der Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen und mit dem Erdboden verbunden oder dazu bestimmt sind, überwiegend standortgebunden genutzt zu werden. Eine (großräumige) erste Tätigkeitsstätte liegt auch vor, wenn eine Vielzahl solcher Mittel, die für sich betrachtet selbständige betriebliche Einrichtungen darstellen können (z.B. Werkstätten und Werkshallen, Bürogebäude und -etagen sowie Verkaufs- und andere Wirtschaftsbauten), räumlich abgrenzbar in einem organisatorischen, technischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten stehen. Demgemäß kommt als eine solche erste Tätigkeitsstätte auch ein großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet (z.B. Werksanlage, Betriebsgelände, Bahnhof oder Flughafen) in Betracht. |
|
|
|
|
21 |
b) Die Zuordnung zu einer solchen Einrichtung wird gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 EStG durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt. |
|
|
|
|
22 |
aa) Nach der gesetzlichen Konzeption - und der die Neuordnung des steuerlichen Reisekostenrechts prägenden Grundentscheidung - wird die erste Tätigkeitsstätte vorrangig anhand der arbeits(vertrag)- oder dienstrechtlichen Zuordnung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber bestimmt, hilfsweise mittels quantitativer Kriterien (BTDrucks 17/10774, S. 15; ebenso BMF-Schreiben vom 24.10.2014 - IV C 5 S 2353/14/10002, BStBl I 2014, 1412 = SIS 14 28 22, Rz 2; Niermann, DB 2013, 1015; Isenhardt, DB 2014, 1316; Thomas, DStR 2014, 497; Blümich/ Thürmer, § 9 EStG Rz 559; Schmidt/Krüger, EStG, 38. Aufl., § 9 Rz 303; Oertel in Kirchhof, EStG, 18. Aufl., § 9 Rz 52; Köhler in Bordewin/Brandt, § 9 EStG Rz 1402; kritisch Bergkemper, FR 2013, 1017; ders. in Herrmann/Heuer/ Raupach - HHR -, § 9 EStG Rz 546). |
|
|
|
|
23 |
bb) Zu den arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungen und Verfügungen (im weiteren Verlauf: arbeitsrechtliche) zählen alle schriftlichen, aber auch mündlichen Absprachen oder Weisungen (BTDrucks 17/10774, S. 15). Die Zuordnung kann also insbesondere im Arbeitsvertrag oder durch Ausübung des Direktionsrechts (bspw. im Beamtenverhältnis durch dienstliche Anordnung) kraft der Organisationsgewalt des Arbeitgebers oder Dienstherrn (im weiteren Verlauf: Arbeitgeber) vorgenommen werden. Die Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte muss dabei nicht ausdrücklich erfolgen. Sie setzt auch nicht voraus, dass sich der Arbeitgeber der steuerrechtlichen Folgen dieser Entscheidung bewusst ist. Wird der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber einer betrieblichen Einrichtung zugeordnet, weil er dort seine Arbeitsleistung erbringen soll, ist diese Zuordnung aufgrund der steuerrechtlichen Anknüpfung an das Dienst- oder Arbeitsrecht vielmehr auch steuerrechtlich maßgebend. Deshalb bedarf es neben der arbeitsrechtlichen Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung keiner gesonderten Zuweisung zu einer ersten Tätigkeitsstätte für einkommensteuerrechtliche Zwecke. Denn der Gesetzgeber wollte mit der Neuregelung des steuerlichen Reisekostenrechts auch das Auseinanderfallen der arbeitsrechtlichen von der steuerrechtlichen Einordnung bestimmter Zahlungen als Reisekosten verringern (BTDrucks 17/10774, S. 15). Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer aus der Sicht ex ante nach den arbeitsrechtlichen Festlegungen an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten tätig werden sollte. |
|
|
|
|
24 |
cc) Die arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers als solche muss für ihre steuerliche Wirksamkeit nicht dokumentiert werden (a.A. BMF-Schreiben in BStBl I 2014, 1412 = SIS 14 28 22, Rz 10). Eine Dokumentationspflicht ist § 9 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht zu entnehmen. Die Feststellung einer entsprechenden Zuordnung ist vielmehr durch alle nach der FGO zugelassenen Beweismittel möglich und durch das FG im Rahmen einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu treffen. So entspricht es regelmäßig der Lebenswirklichkeit, dass der Arbeitnehmer der betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers zugeordnet ist, in der er tatsächlich tätig ist oder werden soll. |
|
|
|
|
25 |
dd) Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätigkeitsstätte arbeitsrechtlich zugeordnet, kommt es aufgrund des Direktionsrechts des Arbeitgebers für das Auffinden der ersten Tätigkeitsstätte auf den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit, die der Arbeitnehmer dort ausübt oder ausüben soll, entgegen der bis 2013 geltenden Rechtslage nicht mehr an (BTDrucks 17/10774, S. 15; BMF-Schreiben in BStBl I 2014, 1412 = SIS 14 28 22, Rz 8; Niermann, DB 2013, 1015; Bergkemper, FR 2013, 1017; Blümich/Thürmer, § 9 EStG Rz 551, 554 und 559; Schmidt/Krüger, a.a.O., § 9 Rz 303; Oertel in Kirchhof, a.a.O., § 9 Rz 52; Köhler in Bordewin/Brandt, § 9 EStG Rz 1402; Lochte in Frotscher/Geurts, EStG, Freiburg 2018, § 9 Rz 122b und 252a; A. Claßen in Lademann, EStG, § 9 EStG Rz 68; Schramm/Harder-Buschner, Neue Wirtschafts-Briefe 2014, 26, 33; kritisch HHR/Bergkemper, § 9 EStG Rz 546). |
|
|
|
|
26 |
Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er arbeitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild gehören. Nur dann kann die „erste Tätigkeitsstätte“ als Anknüpfungspunkt für den Ansatz von Wegekosten nach Maßgabe der Entfernungspauschale und als Abgrenzungsmerkmal gegenüber einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit dienen. Dies folgt nach Auffassung des erkennenden Senats insbesondere aus § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG, der zumindest für den Regelfall davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer an diesem Ort auch tätig werden soll. Darüber hinaus ist das Erfordernis einer arbeitsvertrag- oder dienstrechtlich geschuldeten Betätigung an diesem Ort nicht zuletzt dem Wortsinn des Tatbestandsmerkmals „erste Tätigkeitsstätte“ geschuldet. Denn ein Ort, an dem der Steuerpflichtige nicht tätig wird (oder für den Regelfall nicht tätig werden soll), kann nicht als Tätigkeitsstätte angesehen werden. Schließlich zwingt auch das objektive Nettoprinzip, den Begriff der ersten Tätigkeitsstätte dahingehend auszulegen. Denn anderenfalls bestimmt sich die Steuerlast nicht - gleichheitsrechtlich geboten - nach der individuellen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen, sondern nach dem Belieben seines Arbeitgebers. |
|
|
|
|
27 |
c) Von einer dauerhaften Zuordnung ist ausweislich der in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG aufgeführten Regelbeispiele insbesondere auszugehen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte entsprechend § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft |
|
|
1. typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder |
|
|
2. je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. |
|
|
|
|
28 |
aa) Eine Zuordnung ist unbefristet i.S. des § 9 Abs. 4 Satz 3 1. Alternative EStG, wenn die Dauer der Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte aus der maßgeblichen Sicht ex ante nicht kalendermäßig bestimmt ist und sich auch nicht aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt. |
|
|
|
|
29 |
bb) Die Zuordnung erfolgt gemäß § 9 Abs. 4 Satz 3 2. Alternative EStG für die Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisses, wenn sie aus der maßgeblichen Sicht ex ante für die gesamte Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisses Bestand haben soll. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn die Zuordnung im Rahmen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses unbefristet oder (ausdrücklich) für dessen gesamte Dauer erfolgt. |
|
|
|
|
30 |
4. Nach diesen Maßstäben ist das FG zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin im Streitjahr ihre erste Tätigkeitsstätte am Flughafen X hatte. |
|
|
|
|
31 |
a) Nach den bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO) Feststellungen des FG verfügt die A am Flughafen X über mehrere Betriebsgebäude. Diese innerhalb wie außerhalb des Sicherheitsbereichs befindlichen Gebäude, in denen auch die sog. Briefingräume der A belegen sind, bilden die „A-basis“ X, die steuerrechtlich eine ortsfeste (großräumige) betriebliche Einrichtung - hier des Arbeitgebers der Klägerin - bildet. Denn die Gebäude stehen in einem organisatorischen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers. Sie bilden eine räumlich abgrenzbare funktionale betriebliche Einheit. |
|
|
|
|
32 |
b) Dieser betrieblichen Einrichtung war die Klägerin auch dauerhaft zugeordnet. |
|
|
|
|
33 |
aa) Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat ebenfalls bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) wurde die Klägerin ab Dezember 2011 vom Flughafen Y - Y/0/0 - (zurück) zum Flughafen X (X/0/1) versetzt. Einkommensteuerrechtlich stellt sich diese arbeitsrechtliche Weisung als Zuordnung zur A-basis am Flughafen X i.S. von § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG dar. Der Klägerin wurde dadurch der Flughafen X verbindlich als home base zugewiesen. Denn sie hatte nunmehr von dort aus ihren Dienst anzutreten und zu beenden. |
|
|
|
|
34 |
bb) Diese Zuordnung erfolgte auch unbefristet. Dem steht der Umstand, dass die Klägerin (jederzeit) erneut an einen anderen Ort versetzt werden konnte, nicht entgegen. Denn die Zuordnung zur A-basis am Flughafen X war weder kalendermäßig bestimmt noch ergab sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung eine Befristung. Die jederzeitige Möglichkeit einer Versetzung als solche führt noch nicht zu einer lediglich befristeten Zuordnung. |
|
|
|
|
35 |
cc) Ebenso wenig vermag der Einwand der Klägerin, die A habe mit der Zuweisung einer home base lediglich nationalen wie EU-rechtlichen Vorgaben, insbesondere Ziffer 1.7 des Anhangs III Abschn. Q OPS 1.1095 der Verordnung (EG) Nr. 859/2008 der Kommission vom 20.8.2008 (EU-OPS; Amtsblatt der Europäischen Union - ABlEU - L 254, S. 1) Rechnung tragen, aber keine erste Tätigkeitsstätte i.S. von § 9 Abs. 4 EStG zuweisen wollen, vorliegend gegen eine erste Tätigkeitsstätte der Klägerin am Flughafen X zu streiten. Denn einer gesonderten Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte für einkommensteuerliche Zwecke bedarf es nicht. Die in Ziffer 1.7 des Anhangs III Abschn. Q OPS 1.1095 der Verordnung (EG) Nr. 859/2008 der Kommission vom 20.8.2008 (EU-OPS; ABlEU L 254, S. 1) geregelte Verpflichtung von Luftfahrtunternehmen, für jedes Besatzungsmitglied eine Heimatbasis festzulegen, und die arbeitsvertragliche Umsetzung der dahingehenden Verpflichtung verdeutlicht vielmehr den vom Steuergesetzgeber beabsichtigten Gleichklang von Arbeits- und Steuerrecht. |
|
|
|
|
36 |
dd) Ebenso rechtsunerheblich ist der Einwand der Klägerin, ihr sei der Stationierungsflughafen schon vor der Einführung des neuen Reisekostenrechts von ihrem Arbeitgeber zugewiesen worden. Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Arbeitgeber für einen bereits abgelaufenen Veranlagungszeitraum nicht rückwirkend eine bislang unterbliebene Zuordnungsentscheidung nachholen kann. Dies ist im Streitfall jedoch nicht der Fall. Denn das Versetzungsschreiben vom November 2011 ist zukunftsbezogen. Im Übrigen gilt auch insoweit die Maßgeblichkeit der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegung. Sofern diese - wie vorliegend - auch jenseits des 31.12.2013 fortwirkt, bedarf es keiner erneuten und insbesondere einkommensteuerrechtlichen Festlegung einer ersten Tätigkeitsstätte i.S. von § 9 Abs. 4 EStG. Vielmehr nimmt das neue - zum 1.1.2014 in Kraft getretene - steuerliche Reisekostenrecht die vorgefundenen arbeits- und dienstrechtlichen Festlegungen des Arbeitgebers auf. |
|
|
|
|
37 |
c) Da die Klägerin der A-basis am Flughafen X damit bereits aufgrund der dienstrechtlichen Festlegung ihres Arbeitgebers i.S. des § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG dauerhaft zugeordnet war, kommt es auf die Erfüllung der quantitativen Kriterien des § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG im Streitfall nicht an. |
|
|
|
|
38 |
d) Schließlich ist die Klägerin dort auch in dem erforderlichen Umfang tätig geworden. |
|
|
|
|
39 |
Nach den bindenden Feststellungen des FG war die Klägerin im Streitjahr - wenn auch in geringem Umfang - in der A-basis am Flughafen X tätig. Denn zu den Aufgaben der Klägerin gehörte es u.a., vor jedem Abflug in der A-basis auf dem Flughafen X an dem 60- bis 100-minütigen Briefing der Flugbesatzung teilzunehmen, die Wettermeldungen zu überprüfen, sich an der Beurteilung der Wetterlage zu beteiligen, alle notwendigen Unterlagen und Informationen zur Durchführung des Fluges einzuholen, den Flugplan zu überprüfen, sich mit dem technischen Status des Flugzeugs vertraut zu machen und die Abflugdaten zu errechnen. Nach dem Flug musste sie den Kommandanten bei der Vervollständigung der Flugunterlagen unterstützen und auf Anweisung schriftliche Berichte erstellen. |
|
|
|
|
40 |
Die Würdigung des FG, dass die Klägerin damit in hinreichendem Umfang ihre eigentliche Berufstätigkeit als Copilotin auch in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung ihres Arbeitgebers am Flughafen X ausgeübt hat, ist danach revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Denn insbesondere die Teilnahme an dem vor jedem Flug obligatorischen Briefing zählt zu den arbeitsvertraglichen Pflichten der Klägerin und gehört zu dem von ihr ausgeübten Beruf der Flugzeugführerin. Der Umstand, dass die Klägerin ihre Tätigkeit schwerpunktmäßig in einem Flugzeug ausübt, das mangels Ortsfestigkeit seinerseits keine erste Tätigkeitsstätte ist, steht dem - wie oben ausgeführt - nach der Neuordnung des steuerlichen Reisekostenrechts nicht mehr entgegen. |
|
|
|
|
41 |
5. Da die Klägerin im Streitjahr eine erste Tätigkeitsstätte auf dem Betriebsgelände der A am Flughafen X hatte, sind ihre Aufwendungen für die Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Flughafen X mit der vom FA bereits berücksichtigten Entfernungspauschale gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG abgegolten. Ein Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip ist dadurch nicht zu beklagen. Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass durch die Entfernungspauschale Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte abgegolten werden (Senatsurteil vom 4.4.2019 - VI R 27/17, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt). |
|
|
|
|
42 |
6. Ein Ansatz der begehrten Mehraufwendungen für Verpflegung kommt ebenfalls nicht in Betracht, da die Klägerin nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) nicht nachgewiesen hat, dass sie an den entsprechenden Tagen - wie in § 9 Abs. 4a Sätze 2 und 3 Nr. 3 EStG vorausgesetzt - mehr als acht Stunden von ihrer Wohnung und dem Betriebsgelände der A am Flughafen X als ersten Tätigkeitsstätte abwesend war. Eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden nur von der Wohnung reicht nach dem Gesetzeswortlaut nicht aus. |
|
|
|
|
43 |
7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. |