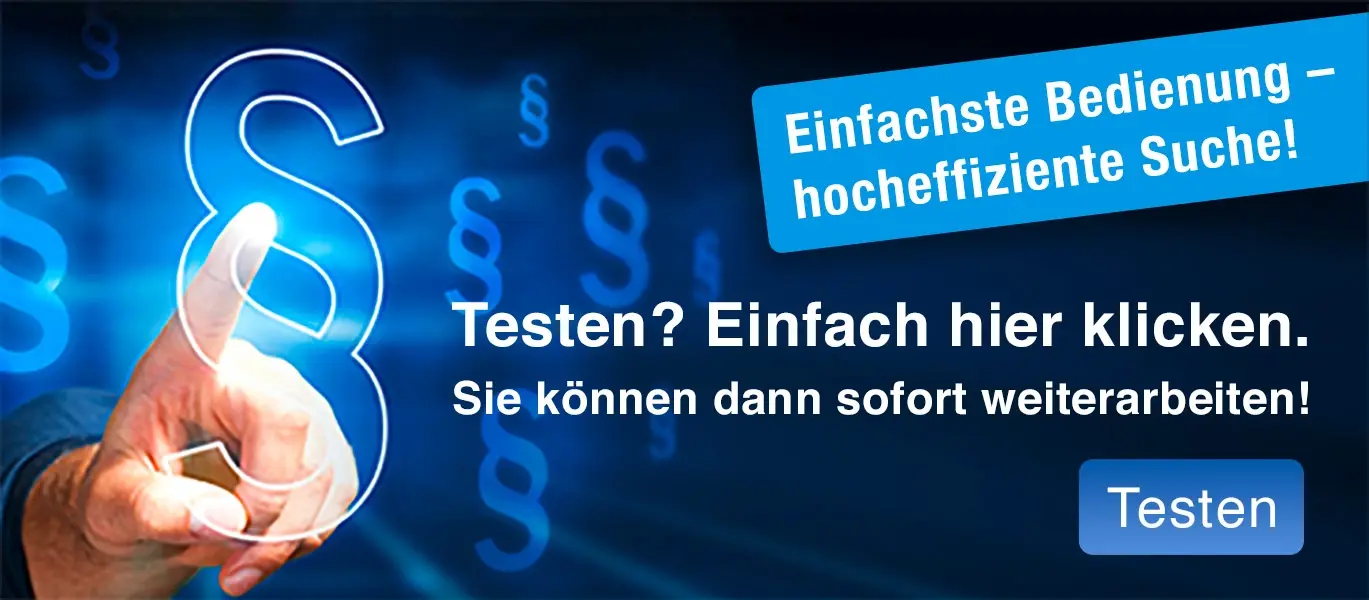Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil
des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 29.05.2024 - 3 K
36/24 = SIS 24 12 27 aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der
Kläger zu tragen.
|
6
|
Mit Einkommensteuerbescheid 2019 vom
03.03.2021 erfasste das FA Einkünfte aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft in Höhe von 40.655 EUR.
Am 06.05.2021 und 09.11.2021 erging jeweils ein aus nicht
streitigen Gründen geänderter Einkommensteuerbescheid
2019. Der gegen die Erfassung des privaten
Veräußerungsgeschäfts eingelegte Einspruch blieb
erfolglos.
|
|
|
|
|
7
|
Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit
Urteil vom 29.05.2024 - 3 K 36/24 (EFG 2024, 1586 = SIS 24 12 27)
statt. Teilentgeltliche Übertragungen einer Immobilie
unterhalb der historischen Anschaffungskosten seien keine
Veräußerungen im Sinne des § 23 EStG. Zwar
führe die Übernahme von Verbindlichkeiten durch den
Erwerber zu Anschaffungskosten. Im Wege der teleologischen
Reduktion sei die teilentgeltliche Übertragung im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge aus dem Tatbestand des § 23 EStG
auszuscheiden. Bei Übertragungen unter den historischen
Anschaffungskosten komme es zu keinem realisierten Wertzuwachs, der
der Besteuerung zugänglich sei. Anderenfalls unterliege ein
fiktiver steuerlicher Ertrag aus einem Vermögenstransfer im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge ohne positiven Cashflow beim
Übertragenden der Ertragsteuer. Dem Kläger werde ein
Gewinn zugerechnet, ohne dass ihm entsprechende Mittel zugeflossen
seien. Zugleich entstehe eine Doppelbesteuerung des identischen
Sachverhalts einerseits bei der Ertragsteuer nach § 23 EStG,
andererseits nach § 7 des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) als gemischte Schenkung. Auch im
Wege einer verfassungskonformen Auslegung des § 23 EStG seien
keine Einkünfte aus privaten
Veräußerungsgeschäften zu versteuern. Die
verfassungsrechtliche Rechtsprechung stehe einer Besteuerung nur
fiktiver Einkünfte entgegen.
|
|
|
|
|
8
|
Mit seiner Revision trägt das FA vor:
Die angefochtene Entscheidung stehe in Widerspruch zum Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12.12.2023 - IX R 15/23 = SIS 24 06 12.
Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von
Wirtschaftsgütern des Privatvermögens sei eine Aufteilung
in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil
nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des
Wirtschaftsguts vorzunehmen. Die Anschaffungskosten seien
entsprechend der Entgeltlichkeitsquote aufzuteilen. Die Befreiung
von einer Verbindlichkeit sei als Gegenleistung beziehungsweise
Entgelt anerkannt. Insoweit liege auch ein Wertzuwachs vor, der die
steuerliche Leistungsfähigkeit erhöhe. Die vom FG
angewandte modifizierte Trennungstheorie widerspreche § 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 23 Abs. 1 Satz 3 und § 23 Abs. 3
Satz 1 EStG. In Höhe der übernommenen Verbindlichkeit
liege ein Veräußerungspreis vor, im Übrigen sei die
Übertragung unentgeltlich gewesen. Die Veräußerung
an einen nahen Angehörigen zu einem geringeren Preis als dem
Verkehrswert erfolge in der Regel aus persönlichen
Gründen, weil ein Teil der Immobilie schenkweise
übergehen solle. Der Kläger habe die Immobilie nicht voll
unentgeltlich zuwenden wollen. Eine Doppelbesteuerung mit
Einkommensteuer und Schenkungsteuer liege nicht vor.
|
|
|
|
|
9
|
Das FA beantragt
sinngemäß,
|
|
|
das Urteil des FG vom 29.05.2024 - 3 K
36/24 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
|
|
|
|
|
10
|
Der Kläger beantragt
sinngemäß,
|
|
|
die Revision zurückzuweisen.
|
|
|
|
|
11
|
Der Kläger hält daran fest, dass
in Fällen, in denen der Veräußerungserlös
unterhalb der historischen Anschaffungskosten liege, kein
Wertzuwachs und damit kein Veräußerungsgewinn erzielt
werde. Sein Vermögen habe sich nicht erhöht, sondern -
wenn man auf den Verkehrswert abstelle - um 210.000 EUR ./. 115.000
EUR = 95.000 EUR vermindert. Fiktive, nicht realisierte Gewinne
könnten nicht der Besteuerung unterfallen. Die Frage, ob die
strenge oder die modifizierte Trennungstheorie anzuwenden sei,
stelle sich nur, wenn der Veräußerungserlös
oberhalb der historischen Anschaffungskosten liege. Zudem
hätten weder er noch seine Tochter in der Übernahme der
Verbindlichkeiten eine Kaufpreiszahlung gesehen.
|
|
|
|
|
12
|
II. Die Revision ist begründet. Das
angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§
126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung - FGO - ).
|
|
|
|
|
13
|
Das FG hat rechtsfehlerhaft das Vorliegen
eines Gewinns aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 EStG verneint und damit Bundesrecht verletzt (dazu
unter 1. und 2.). Das Urteil ist daher aufzuheben und die Klage
abzuweisen (dazu unter 3.).
|
|
|
|
|
14
|
1. Infolge der Übertragung des
Grundstücks hat der Kläger im Streitjahr ein privates
Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2 i.V.m.
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG getätigt.
|
|
|
|
|
15
|
a) Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu
den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG)
auch Einkünfte aus privaten
Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 EStG.
Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
EStG Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken
und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (zum Beispiel Erbbaurecht,
Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre
beträgt. Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem
Einzelrechtsnachfolger nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG die
Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in
das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger
zuzurechnen.
|
|
|
|
|
16
|
Als Anschaffung und Veräußerung
werden im Regelfall der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche
Übertragung eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person
aufgefasst (vgl. Senatsurteile vom 06.09.2016 - IX R 45/14, BFHE
255, 162, BStBl II 2018, 329 = SIS 16 25 49, Rz 20 und vom
23.07.2019 - IX R 28/18, BFHE 265, 258, BStBl II 2019, 701 = SIS 19 13 51, Rz 18, m.w.N.). Die Übernahme von Schulden beim Erwerb
eines Wirtschaftsguts stellt eine entgeltliche Gegenleistung dar.
Es liegt in Höhe der Schuldübernahme ein Entgelt vor
(vgl. Senatsurteil vom 03.09.2019 - IX R 8/18, BFHE 266, 173, BStBl
II 2020, 122 = SIS 19 19 28, Rz 14, m.w.N.; Hentschel in
Herrmann/Heuer/Raupach - HHR -, § 23 EStG Rz 231; Wernsmann in
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff - KSM -, EStG, § 23 Rz B
72).
|
|
|
|
|
17
|
b) Der Kläger hat ein im Jahr 2014
angeschafftes Grundstück im März 2019 und damit innerhalb
der Zehnjahresfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
veräußert. Mit der Übernahme der mit dem
Grundstück zusammenhängenden Verbindlichkeit seitens der
Tochter und der damit verbundenen Schuldfreistellung hat der
Kläger auch ein Entgelt in Höhe von 115.000 EUR erzielt.
Er hat damit das Grundstück (teil-)entgeltlich an seine
Tochter veräußert.
|
|
|
|
|
18
|
2. Dem Kläger ist im Streitjahr auch ein
Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft
entstanden.
|
|
|
|
|
19
|
a) Nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG ist der
Gewinn oder Verlust aus Veräußerungsgeschäften im
Sinne des § 23 Abs. 1 EStG der Unterschied zwischen
Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits. Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um AfA,
erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei
der Ermittlung der Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 bis 7 EStG abgezogen worden sind (§ 23 Abs. 3 Satz 4
EStG). Im Fall des unentgeltlichen Erwerbs übernimmt der
Einzelrechtsnachfolger die (historischen) Anschaffungskosten des
Rechtsvorgängers. Ein Gewinn oder Verlust entsteht insoweit
nicht.
|
|
|
|
|
20
|
b) Im Fall der teilentgeltlichen
Übertragung von Wirtschaftsgütern des
Privatvermögens erfolgt nach der ständigen Rechtsprechung
für einkommensteuerliche Zwecke eine Aufteilung in einen voll
entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil nach dem
Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des
übertragenen Wirtschaftsguts (vgl. u.a. BFH-Urteile vom
17.07.1980 - IV R 15/76, BFHE 131, 329, BStBl II 1981, 11 = SIS 81 05 25; vom 14.06.2005 - VIII R 37/03, juris = SIS 05 48 07, unter
II.2.d; vom 10.11.1998 - VIII R 28/97, BFH/NV 1999, 616 = SIS 98 52 15, unter II.1.b am Ende und Senatsurteil vom 12.12.2023 - IX R
15/23 = SIS 24 06 12, Rz 21). Die Anschaffungskosten werden sodann
entsprechend der
„Entgeltlichkeitsquote“
aufgeteilt.
|
|
|
|
|
21
|
Diese Grundsätze gelten auch für
teilentgeltliche Übertragungen in den Fällen des §
23 EStG (vgl. Senatsurteile vom 29.06.2011 - IX R 63/10, BFHE 234,
182, BStBl II 2011, 873 = SIS 11 27 18, Rz 16 und vom 12.12.2023 -
IX R 15/23 = SIS 24 06 12, Rz 22; ähnlich bereits
Senatsurteile vom 22.09.1987 - IX R 15/84, BFHE 151, 143, BStBl II
1988, 250 = SIS 88 02 11, unter 2. und vom 20.04.2004 - IX R 5/02,
BFHE 206, 110, BStBl II 2004, 987 = SIS 04 22 23).
|
|
|
|
|
22
|
c) Diese Aufteilung entspricht dem
Gesetzeswortlaut. Denn die Regelungen in § 23 Abs. 1 Satz 1
EStG einerseits und § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG andererseits gehen
ausdrücklich von einer Unterscheidung zwischen voll
entgeltlicher und voll unentgeltlicher Übertragung aus. Nur
der voll entgeltliche Teil ist im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1
EStG veräußert, der voll unentgeltliche Teil der
Übertragung ist es mangels Veräußerungspreises
nicht. Die daraus folgende Aufteilung in einen voll entgeltlich und
einen voll unentgeltlich übertragenen Teil ist keine
Besteuerung eines fiktiven Sachverhalts, sondern lediglich ein
Hilfsmittel zur Beschreibung der Rechtsfolgen, die das Gesetz an
den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt knüpft (so in
Bezug auf § 17 EStG Senatsurteil vom 12.12.2023 - IX R 15/23 =
SIS 24 06 12, Rz 22 f.). Daher kann sich der Kläger nicht
darauf berufen, er habe mit der Übernahme der
Verbindlichkeiten durch seine Tochter im Ergebnis weniger erhalten
als seine historischen Anschaffungskosten. Denn bezogen auf den
entgeltlichen Teil der Übertragung von 54,76 % stehen seinen
anteiligen Anschaffungskosten in Höhe von 78.828 EUR ein
Entgelt in Höhe von 115.000 EUR gegenüber. Der
Kläger hat mithin bezogen auf den entgeltlichen Teil einen
Wertzuwachs erzielt.
|
|
|
|
|
23
|
d) Das Schrifttum schließt sich dieser
Auffassung fast ausschließlich an (HHR/Hentschel, § 23
EStG Rz 231, 236; Kube in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 23
Rz 11; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed. 01.11.2024, EStG § 23 Rz
238; Brandis/Heuermann/Ratschow, § 23 EStG Rz 156;
Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 23 Rz 38; Schmidt/Kulosa,
EStG, 43. Aufl., § 6 Rz 793; KKB/Bäuml/Müller,
§ 23 EStG, 10. Aufl., Rz 233; Grondorf in Bordewin/Brandt,
§ 23 EStG Rz 90; Wernsmann in KSM, EStG, § 23 Rz B 67; T.
Carlé in Korn, § 23 EStG Rz 65; Leister in
Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 06.2024, §
23 EStG Rz 52 f.; Merker in EStG - eKomm, § 23 EStG Rz 50,
Stand: 10.01.2025; Wunderlich in Kappler/Kappler, Die
vorweggenommene Erbfolge, 2. Aufl. 2023, Rz 1002; Günther,
DStZ 2021, 970, 972 f.; Vees, DStR 2013, 681, 682; Heuermann, DB
2013, 1328, 1329; Wiesmann, HFR 2024, 625; Köster, DStZ 2024,
389; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 05.10.2000,
BStBl I 2000, 1383 = SIS 00 12 25, Rz 30; a.A. Demuth, Der
Ertragsteuerberater 2012, 457, 459; Strahl, FR 2013, 322, 325
f.).
|
|
|
|
|
24
|
Die Verlängerung der Spekulationsfrist in
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auf zehn Jahre vermag an diesem
Ergebnis nichts zu ändern. Mit der infolge des
Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24.03.1999 (BGBl I
1999, 402) verlängerten Frist von zehn Jahren wollte der
Gesetzgeber an dem Grundsatz, dass Wertsteigerungen an
Wirtschaftsgütern des Privatvermögens grundsätzlich
nicht steuerbar sind, nichts ändern. Ebenso hat er nicht zu
erkennen gegeben, an der bisherigen Handhabung teilentgeltlicher
Übertragungen Änderungen vornehmen zu wollen (vgl.
BT-Drucks. 14/23, S. 179 f.).
|
|
|
|
|
25
|
e) Für die teilentgeltliche
Übertragung von Wirtschaftsgütern des
Betriebsvermögens unter Beteiligung von Mitunternehmerschaften
(§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG) ist zwar umstritten, ob eine
Aufteilung des Vorgangs in einen entgeltlichen und einen
unentgeltlichen Teil zu erfolgen hat, der Buchwert des
übertragenen Wirtschaftsguts jedoch bis zur Höhe des
Entgelts dem entgeltlichen Teil und im Übrigen dem
unentgeltlichen Teil zuzuordnen ist (Überblick vgl.
BFH-Beschluss vom 19.03.2014 - X R 28/12, BFHE 245, 164, BStBl II
2014, 629 = SIS 14 18 34). Die Anwendung dieser sogenannten
modifizierten Trennungstheorie scheidet aber auf im
Privatvermögen befindliche Wirtschaftsgüter aus (vgl.
dazu Senatsurteil vom 12.12.2023 - IX R 15/23 = SIS 24 06 12, Rz 26
ff., mit weiteren Ausführungen zur Streitfrage).
|
|
|
|
|
26
|
f) Zwar bezog sich die Senatsentscheidung vom
12.12.2023 - IX R 15/23 = SIS 24 06 12 auf den Fall, dass der
Veräußerungspreis über den historischen
Anschaffungskosten lag. Die in der Senatsentscheidung vom
12.12.2023 - IX R 15/23 = SIS 24 06 12 unter Rz 31 angeführten
Bedenken hinsichtlich einer Anwendung der modifizierten
Trennungstheorie gelten jedoch in gleicher Weise für den hier
vorliegenden Sachverhalt, bei dem die Übernahme der
Verbindlichkeiten durch die Tochter als Rechtsnachfolgerin unter
den historischen Anschaffungskosten des Klägers als
Rechtsvorgänger liegt. Auch im Bereich des § 23 EStG
bestehen keine Anhaltspunkte dafür, im Fall einer gemischten
Schenkung (künstlich) steuerrechtlich relevante Verluste zu
erzeugen. Nach der modifizierten Trennungstheorie würde zwar
kein Verlust entstehen, weil dem entgeltlichen Teil nur die
(gegebenenfalls um die AfA bereinigten) Anschaffungskosten bis zur
Höhe des Entgelts zugeordnet würden und im Übrigen
dem unentgeltlichen Teil. Ein Veräußerungsverlust
entstünde allenfalls in Höhe der zu
berücksichtigenden Veräußerungskosten. Allerdings
widerspricht dies § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG, wonach bei einem
unentgeltlichen Erwerb die Anschaffungskosten des
Rechtsvorgängers maßgeblich sind. Ferner blieben
Steigerungen des Verkehrswerts vom historischen
Anschaffungszeitpunkt bis zum maßgeblichen Stichtag der
Übertragung gänzlich unberücksichtigt.
|
|
|
|
|
27
|
Zudem würde sich die Minderung der
Anschaffungskosten durch die AfA nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG
gewinnerhöhend erst bei einer Weiterveräußerung
durch den Einzelrechtsnachfolger auswirken. Nutzt dieser die
Immobilie selbst im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3
EStG zu eigenen Wohnzwecken, wirkte sich die Korrektur um die
abgezogenen AfA-Beträge im Ergebnis nicht aus.
|
|
|
|
|
28
|
g) Auch die übrigen vom Kläger und
vom FG angeführten Gesichtspunkte führen zu keinem
abweichenden Ergebnis.
|
|
|
|
|
29
|
aa) Soweit das FG auf die Doppelbesteuerung
mit Einkommensteuer und Erbschaftsteuer hinweist, fehlt es an
Feststellungen, ob und in welcher Höhe die streitige
Immobilienübertragung überhaupt zu einer Belastung mit
Schenkungsteuer geführt hat. Selbst wenn dies aufgrund von
späteren Übertragungen innerhalb der Frist des § 14
ErbStG noch der Fall sein sollte, fehlte es im Streitfall an einer
solchen Doppelbesteuerung. Im Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuerrecht gilt die Übernahme von Verbindlichkeiten
als entgeltlicher Vorgang, und die übernommene Verbindlichkeit
wird vom steuerpflichtigen Erwerb abgezogen (vgl. R E 7.4 Abs. 1
Satz 2 der Erbschaftsteuer-Richtlinien 2020). Soweit die
Übertragung entgeltlich erfolgt, unterliegt der
Vermögensanfall nach § 1 Nr. 2, § 7 Abs. 1 Nr. 1
ErbStG mangels Bereicherung daher nicht der Besteuerung. In die
schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage geht im Ergebnis nur der
unentgeltliche Teil des Rechtsgeschäfts ein. Mit
Einkommensteuer aufgrund der Einordnung als privates
Veräußerungsgeschäft wird hingegen nur der
entgeltliche Teil des Rechtsgeschäfts besteuert.
|
|
|
|
|
30
|
bb) Die vom FG angeführte teleologische
Reduktion der Vorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
(vgl. zur teleologischen Reduktion u.a. BFH-Urteile vom 09.03.2023
- IV R 11/20, BFHE 279, 531, BStBl II 2023, 830 = SIS 23 10 46, Rz
29 und vom 08.05.2024 - VIII R 28/20 = SIS 24 13 91, zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt, Rz 55) kann schon deshalb nicht zur
Anwendung kommen, weil es an Anhaltspunkten fehlt, dass eine
verdeckte oder planwidrige Regelungslücke des Gesetzgebers
vorliegt. Anhaltspunkte dafür, dass § 23 EStG nur
für vollentgeltliche Rechtsgeschäfte gelten soll, finden
sich nicht. Vielmehr sind sowohl der entgeltliche Erwerb (§ 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3 EStG) als auch der
unentgeltliche Erwerb (§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG) im Gesetz
ausdrücklich geregelt.
|
|
|
|
|
31
|
cc) Eine verfassungskonforme Auslegung dieser
Vorschriften aufgrund einer möglichen Verletzung von Art. 3
Abs. 1 oder Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes kommt nicht in
Betracht. Unbeschadet der Frage, ob der Streitfall überhaupt
Anhaltspunkte für eine doppelte Belastung mit Schenkungsteuer
und Einkommensteuer hergibt, ist zu berücksichtigen, dass der
Gesetzgeber eine gleichzeitige Belastung mit diesen beiden
Steuerarten einschließlich der damit verbundenen Härten
grundsätzlich in Kauf genommen hat (vgl. BFH-Urteil vom
25.06.2021 - II R 31/19, BFHE 275, 240, BStBl II 2022, 497 = SIS 22 05 06, Rz 31, m.w.N.). Auch seitens des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) ist eine kumulative Belastung mit Erbschaftsteuer und
Einkommensteuer nicht beanstandet worden (vgl. BVerfG-Beschluss vom
07.04.2015 - 1 BvR 1432/10 = SIS 15 13 83, Rz 11 ff.).
|
|
|
|
|
32
|
dd) Schließlich spielt keine Rolle, dass
der Kläger und seine Tochter von einer insgesamt
unentgeltlichen Übertragung ausgegangen sind. Für die
Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist auf die
objektiv verwirklichten Besteuerungsmerkmale abzustellen.
Subjektive Erwägungen wie zum Beispiel eine Spekulations- oder
Überschusserzielungsabsicht sind unerheblich (vgl. u.a.
HHR/Hentschel, § 23 EStG Rz 81 f.; Kube in Kirchhof/Seer,
EStG, 24. Aufl., § 23 Rz 1; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed.
01.11.2024, EStG § 23 Rz 108, 121; Brandis/Heuermann/Ratschow
§ 23 EStG Rz 17; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 23
Rz 2).
|
|
|
|
|
33
|
h) Das FG ist bei der Ermittlung der
Einkünfte aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft von anderen
Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil kann deshalb keinen
Bestand haben und ist aufzuheben. Vielmehr ist unter Anwendung der
dargestellten Grundsätze der Veräußerungsgewinn
nach § 23 Abs. 3 EStG zu ermitteln, indem dem anteiligen
Veräußerungspreis die anteiligen Anschaffungskosten,
bereinigt um die anteiligen AfA nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG,
gegenüberzustellen sind. Der Abzug der
Veräußerungskosten erfolgt ebenfalls lediglich in
Höhe der Entgeltlichkeitsquote. Daraus ergibt sich zutreffend
der vom FA angesetzte steuerbare Veräußerungsgewinn in
Höhe von 40.655 EUR.
|
|
|
|
|
34
|
3. Die Sache ist spruchreif. Der an die Stelle
der angefochtenen Einkommensteuerbescheide 2019 vom 03.03.2021 und
06.05.2021 getretene Einkommensteuerbescheid vom 09.11.2021 erfasst
die Einkünfte aus dem privaten
Veräußerungsgeschäft des Klägers. Die Klage
ist abzuweisen.
|
|
|
|
|
35
|
4. Die Kostenentscheidung beruht auf §
135 Abs. 1 FGO.
|