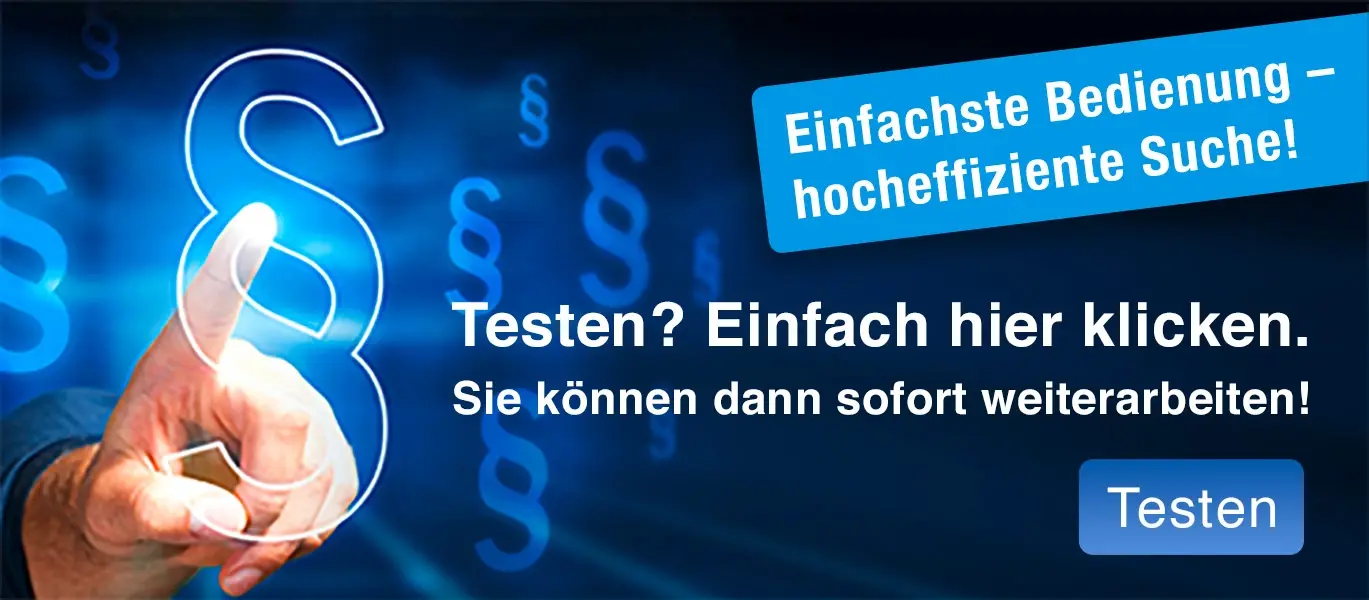
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Nachträglicher Hinzuerwerb einer Milchquote durch den Verkäufer eines Milchwirtschaftsbetriebs
Nachträglicher Hinzuerwerb einer Milchquote durch den Verkäufer eines Milchwirtschaftsbetriebs: 1. Die Milchquote ist jahresbezogen; Hinzuerwerbe während eines Wirtschaftsjahres sind bei der zum 31. März zu erstellenden Abrechnung zu berücksichtigen. Auf den Zeitpunkt der Milchlieferungen und die zu diesem Zeitpunkt verfügbare Milchquote kommt es nicht an. Das gilt auch beim Übergang eines Betriebs während des laufenden Wirtschaftsjahres. - 2. Der Übergang einer Milchquote auf den Verkäufer eines Milchwirtschaftsbetriebs bewirkt eine Erhöhung der dem Verkäufer im Milchwirtschaftsjahr zur Verfügung stehenden Milchquote, so dass bei einer Übergabe des Betriebs während des Milchwirtschaftsjahres die auf den Käufer übergehende Quote entsprechend der mit dem Verkäufer getroffenen Vereinbarung von diesem ggf. auch dann in vollem Umfang beliefert werden kann, wenn sie vom Verkäufer bereits teilweise beliefert worden war. Das gilt auch dann, wenn der Verkäufer erst nach der Übergabe des Betriebs eine Quote hinzuerwirbt. - Urt.; BFH 23.2.2010, VII R 12/09; SIS 10 22 28
Verschiedenes > Verschiedenes, u.a. Zoll, Verbrauchsteuer
-
BFH 23.02.2010, VII R 12/09
BFHE 229 S. 548
BFH/NV 2010 S. 1756
LEXinform 0179814
[VO (EG) Nr. 1788/2003] Art. 5 Buchst. k
[MilchAbgV] § 17 Abs. 1
[FGO] § 118 Abs. 2
|
1 |
I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) hat zum 1.10.2005 einen landwirtschaftlichen Betrieb erworben, mit dem sie Milchwirtschaft betreibt. Der vormalige Eigentümer dieses Betriebs verfügte über eine Milchquote (betriebliche Referenzmenge) von 617.690 kg. Auf diese Milchquote sind nach den vom Finanzgericht (FG) seinem Urteil zugrunde gelegten Feststellungen des Beklagten und Revisionsbeklagten (Hauptzollamt - HZA - ) bis zum Übergang des Betriebs 325.994 kg Milch an die Molkerei geliefert worden. Den betreffenden Feststellungen liegt offenbar zugrunde, dass das HZA der Ansicht ist, dass ein von dem vormaligen Eigentümer für den Zeitraum bis zum Eigentumsübergang auf die Klägerin abgeschlossener Pachtvertrag die Milcherzeugerstellung des Pächters nicht begründet hat, so dass die in diesem Zeitraum produzierten, vorgenannten Milchmengen dem Verkäufer zuzurechnen seien. Dieser soll jedoch, wie die Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragen hat (FG-Akte Bl. 27), vor Ende des Milchwirtschaftsjahres eine Milchquote hinzuerworben haben, welche die von seinem Betrieb bis Ende September 2005 abgelieferten Milchmengen abdeckt. |
|
|
|
|
2 |
Die Landwirtschaftsbehörde hat der Klägerin zunächst bescheinigt, dass die vorgenannte Milchquote von 617.690 kg zum 1.10.2005 auf diese übergegangen sei (Übertragungsbescheinigung vom 2.11.2005). In den Hinweisen, die diesem Bescheid beigefügt waren, war jedoch unter Nr. 7 vermerkt, dass die Molkerei der Klägerin mitteilen werde, welche Milchquote ihr im Milchwirtschaftsjahr 2005/06 unter Berücksichtigung der von dem Verkäufer bereits gelieferten Milchmenge noch verbleibe. |
|
|
|
|
3 |
Unter dem 31.8.2006 hat die Klägerin mit dem Verkäufer eine Vereinbarung getroffen, wonach ihr die von der Landesstelle übertragene Milchquote (617.690 kg) in dem Milchwirtschaftsjahr 2005/06 in vollem Umfang unbeliefert zur Verfügung steht. Aufgrund dieser Vereinbarung hat das HZA zunächst der Klägerin für das betreffende Milchwirtschaftsjahr eine Milchquote von 617.690 kg zugeteilt. Diesen Bescheid hat es jedoch am 1.12.2007, gestützt auf § 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und Direktzahlungen (MOG), zurückgenommen und die Milchquote auf nur noch (617.690 kg minus 325.994 kg =) 291.696 kg festgesetzt. |
|
|
|
|
4 |
Gegen diesen Bescheid richtet sich die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage, die das FG abgewiesen hat. Es urteilte, unzutreffende Milchquotenfestsetzungen seien nach § 10 Abs. 1 MOG zwingend zurückzunehmen; die Vertrauensschutzvorschriften der §§ 48 und 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) stünden der Rücknahme nicht entgegen. Der Rücknahmebescheid sei rechtmäßig, weil der Klägerin nur eine Milchquote von 291.696 kg zustehe. Der Senat habe bereits entschieden (Hinweis auf das Urteil vom 14.4.1989 IV 69/87 S-H, ZfZ 1990, 54), dass der Erwerber für das Jahr des Übergangs der Milchquote nur noch die Quote für sich in Anspruch nehmen könne, die der Abgebende bis zum Übergang nicht für eigene Milchanlieferungen ausgeschöpft hat. Wirksame Vereinbarungen hierüber könnten von den Vertragsparteien nicht getroffen werden. |
|
|
|
|
5 |
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin. Diese wendet sich in erster Linie gegen die Rechtsansicht des FG, Vereinbarungen über den von dem Erwerber eines Betriebs nutzbaren Teil der Milchquote könnten nicht wirksam getroffen werden. Dies widerspreche Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Buchst. k der hier noch anzuwendenden Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 (VO Nr. 1788/2003) des Rates vom 29.9.2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milchsektor (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 270/123) sowie § 7 Abs. 2 der Milchabgabenverordnung (MilchAbgV; hier anzuwenden i.d.F. der zuletzt durch Verordnung vom 9.8.2004, BGBl I 2004, 2140, geänderten Verordnung vom 12.1.2000, BGBl I 2000, 27). Weder die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts noch die des nationalen Rechts stünden einer Vereinbarung zwischen Vertragsparteien über die Modalitäten der Übertragung der Milchquote entgegen. Die Klägerin beruft sich insofern auf den Erwägungsgrund Nr. 17 Satz 3 der VO Nr. 1788/2003. Es sei auch kein Grund dafür ersichtlich, warum Vereinbarungen nur hinsichtlich eines vermeintlich noch nicht belieferten Teils einer Milchquote zulässig sein sollten. Denn eine - allerdings unzulässige - Doppelnutzung der Milchquote könne, wie im vorliegenden Fall, auch dann ausgeschlossen sein, wenn die Milchquote bereits teilweise beliefert worden ist und trotzdem von dem Erwerber in vollem Umfang beliefert wird. Art. 5 Buchst. k VO Nr. 1788/2003 bestimme nämlich ausdrücklich, dass die für die Abgabenberechnung maßgebliche Milchquote derjenigen entspreche, die dem Erzeuger am 31. März des Milchwirtschaftsjahres zur Verfügung steht, wobei alle in der VO vorgesehenen Übertragungen zu berücksichtigen seien, die während des Milchwirtschaftsjahres erfolgt sind. Die VO Nr. 1788/2003 setze dabei nicht voraus, dass der Erzeuger bereits bei Lieferung der Milch an die Molkerei Inhaber einer entsprechenden Milchquote sei; es stehe ihm vielmehr frei, zunächst ohne Milchquote Milch abzuliefern und die Quote erst später während des Milchwirtschaftsjahres z.B. durch Übertragungen gemäß Art. 17 oder 18 VO Nr. 1788/2003 zu erwerben. So sei es hier geschehen; der Verkäufer habe einen Betrieb in ... mit einer ausreichenden Milchquote erworben, um seine eigenen Milchlieferungen abzudecken. Wenn hingegen die Milchquote einem Betriebsinhaber mit Wirkung für das Milchwirtschaftsjahr in voller Höhe entzogen werde, ohne dass sich dieser eine neue Quote beschaffe, müsse er eben entsprechende Abgaben zahlen. |
|
|
|
|
6 |
Ferner verstoße das Urteil des FG gegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 MilchAbgV insofern, als nach dieser Vorschrift der Übergang von Milchquoten durch eine von der zuständigen Landesstelle ausgewiesene Bescheinigung nachzuweisen ist. Diese Bescheinigung sei Grundlagenbescheid und im Streitfall dahin ergangen, dass der Klägerin eine Milchquote von 617.960 kg zusteht. Hiervon dürfe das HZA nicht abweichen. Der Hinweis Nr. 7 könne daran nichts ändern; er sei nicht geeignet, den bindenden Tenor des Bescheids in Frage zu stellen. Denn Sinn und Zweck des Grundlagenbescheids liege gerade darin, Streitigkeiten über den Übergang der Milchquote zu vermeiden; dieser könne deshalb nicht von außerhalb des Bescheids liegenden Umständen abhängig gemacht werden. |
|
|
|
|
7 |
Im Übrigen stehe der Rücknahme der zunächst festgestellten Quote § 48 Abs. 2 VwVfG entgegen. Der Hinweis Nr. 7 in dem Bescheid der Landwirtschaftskammer habe das Vertrauen der Klägerin in den Übergang der vollen Milchquote nicht zerstören können, weil die Landwirtschaftskammer ebenso wie das HZA selbst und die Molkerei zunächst davon ausgegangen seien, dass der Verkäufer in dem ersten Teil des Milchwirtschaftsjahres überhaupt keine Milch abgeliefert habe. |
|
|
|
|
8 |
Im Streitfall komme hinzu, dass der Verkäufer zunächst nicht davon ausgegangen sei, in der ersten Hälfte des Milchwirtschaftsjahres überhaupt Milcherzeuger gewesen zu sein; auch die Klägerin sei davon bei Abschluss des Kaufvertrags nicht ausgegangen. Vor dem Hintergrund zivilrechtlicher Streitigkeiten mit der damaligen Pächterin sei der Verkäufer der Ansicht des HZA, der Pachtvertrag sei nicht anzuerkennen, später nicht entgegengetreten. Die Klägerin habe von alledem keine Kenntnis gehabt und sich darauf verlassen müssen, dass ihr die volle Milchquote zur Verfügung stehe. |
|
|
|
|
9 |
Ergänzend bezieht sich die Klägerin auf das Vorabentscheidungsersuchen des Senats vom 31.3.2009 VII R 23, 24/08 (BFHE 225, 558 = SIS 09 20 88). Bei Verneinung der dort dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gestellten Frage stehe der Klägerin auf jeden Fall die gesamte Milchquote von 617.690 kg zur Verfügung. Aber auch wenn der EuGH diese Frage bejahen sollte, folge daraus nicht, dass eine abweichende Vereinbarung über den Milchquotenübergang zwischen den Beteiligten nicht zulässig sei. Dies sei vielmehr ggf. durch ein neues Vorabentscheidungsersuchen zu klären. |
|
|
|
|
10 |
Das HZA hält die zwischen der Klägerin und dem Verkäufer getroffene Vereinbarung über den Übergang der vollen Milchquote für nichtig und macht sich in diesem Zusammenhang im Wesentlichen die Rechtsansicht des angefochtenen Urteils zu eigen. Dass die Klägerin in Übereinstimmung mit dem Verkäufer bei Abschluss des Kaufvertrags davon ausgegangen sei, dass dieser in dem betreffenden Milchwirtschaftsjahr keine Milch geliefert habe, habe die Klägerin bisher nicht geltend gemacht. Es handele sich um eine neue Tatsache, die in diesem Revisionsverfahren nicht berücksichtigt werden könne. Im Übrigen komme es auf die subjektiven Vorstellungen des Verkäufers über seine Milcherzeugerstellung nicht an (Hinweis auf den Beschluss des Senats vom 22.12.2008 VII B 115/08, BFH/NV 2009, 983 = SIS 09 16 06). |
|
|
|
|
11 |
Auf Vertrauensschutz könne sich die Klägerin nicht berufen. Der Hinweis Nr. 7 habe ein etwaiges Vertrauen zerstören müssen. Die später zwischen der Klägerin und dem Verkäufer getroffene Zusatzvereinbarung und deren Anerkennung durch die Landwirtschaftsbehörde habe keinen Vertrauenstatbestand begründen können. Vielmehr sei der Klägerin das Vertrauen damals schon abhanden gekommen und sie habe das Problem, dass der Verkäufer die Milchquote teilweise bereits beliefert hatte, gerade durch die Zusatzvereinbarung lösen wollen. |
|
|
|
|
12 |
II. Die Revision der Klägerin ist begründet und führt zur Aufhebung des Urteils des FG und zur Zurückverweisung der Sache an dieses zur erneuten Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung - FGO - ). Das Urteil des FG verletzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 FGO). |
|
|
|
|
13 |
Wie der erkennende Senat bereits in seinem Beschluss in BFHE 225, 558 = SIS 09 20 88 ausgeführt hat, beziffert die sog. Milchquote (Referenzmenge) den Umfang des Rechts eines Milcherzeugers, in seinem Betrieb erzeugte Milch an einen Abnehmer zu liefern, ohne dafür eine Milchabgabe zahlen zu müssen. Die Milchquote bezieht sich auf die Summe der Milchlieferungen in einem jeden Zwölfmonatszeitraum (Milchwirtschaftsjahr). Übertragungen, Überlassungen, Umwandlungen oder zeitweilige Neuzuweisungen von Milchquoten, welche während eines Zwölfmonatszeitraums erfolgt sind, sind nach Art. 5 Buchst. k VO Nr. 1788/2003 bei der erst nach Ablauf des Zwölfmonatszeitraums erfolgenden Prüfung zu berücksichtigen, ob der Erzeuger mehr Milch geliefert hat, als seinem Lieferrecht entspricht, und ob er deshalb abgabenpflichtig geworden ist. Die zum 1. April des betreffenden Zwölfmonatszeitraums zugeteilte Milchquote ist also entsprechend zu korrigieren, woraus sich die in Art. 5 Buchst. k VO Nr. 1788/2003 als verfügbare Milchquote bezeichnete Menge ergibt. Mit Recht weist deshalb die Revision sinngemäß darauf hin, dass ein Erzeuger, um abgabenfrei Milch liefern zu können, nicht etwa im Zeitpunkt der Lieferung im Besitz einer entsprechenden Milchquote sein muss; ob er abgabenpflichtig wird, hängt vielmehr ausschließlich davon ab, ob er am Ende des Milchwirtschaftsjahres mehr Milch geliefert hat, als ihm seine Milchquote gestattete, deren Höhe sich ebenfalls erst am Ende des Milchwirtschaftsjahres endgültig bestimmen lässt. § 19 Abs. 2 MilchAbgV bestätigt dies, weil er dahin zu verstehen ist, dass er für den Fall, dass die Milchlieferungen eines Erzeugers voraussichtlich zu einer Abgabenschuld führen werden, gestatten will, von seinem Milchgeld gleichsam Vorauszahlungen auf diese (erst künftig entstehende und überhaupt definitiv feststellbare) Abgabenschuld einzubehalten oder anderweit Sicherheit zu verlangen. |
|
|
|
|
14 |
Im Streitfall hat die Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren sinngemäß vorgetragen, der vormalige Inhaber des von ihr erworbenen Milchwirtschaftsbetriebs habe zwar zunächst nur über eine Milchquote verfügt, die abzüglich der von ihm selbst vor der Betriebsübergabe vorgenommenen Milchlieferungen - deren Zurechnung an den Verkäufer statt an den seinerzeitigen Pächter des von der Klägerin erworbenen Betriebs die Klägerin nicht widersprochen hat und welche auch das FG offenbar ohne weitere Prüfung als zutreffend unterstellt hat - nicht ausreichte, um der Klägerin abgabenfreie Milchlieferungen in dem Umfang zu gestatten, in dem sie diese in der zweiten Hälfte des Milchwirtschaftsjahres tatsächlich vorgenommen hat. Denn liefert ein Erzeuger während eines Zwölfmonatszeitraums Milch an eine Molkerei und macht damit von seiner Milchquote Gebrauch, so kann die Milchquote bzw. der so ausgenutzte Teil der Milchquote in demselben Zwölfmonatszeitraum weder von ihm noch von irgendeinem anderen Erzeuger dafür in Anspruch genommen werden, Milch abgabenfrei liefern zu dürfen, weil die Milchquote, wie dargelegt, das Recht zu einer einmaligen Milchlieferung in jedem Zwölfmonatszeitraum in der festgesetzten Höhe darstellt und dieses Recht verbraucht ist, wenn es genutzt worden ist. Die Übertragung einer einmal bereits ausgenutzten Milchquote kann, in welchem rechtlichen Zusammenhang sie auch immer vorgenommen wird, das Recht zur abgabenfreien Milchlieferung in dem betreffenden Zwölfmonatszeitraum nicht wieder aufleben lassen. |
|
|
|
|
15 |
Die Klägerin hat jedoch - wenn auch beiläufig - im erstinstanzlichen Verfahren weiter ausgeführt, der Verkäufer habe vor dem Ende des Milchwirtschaftsjahres einen Betrieb mit einer nicht ausgeschöpften Milchquote hinzuerworben, wodurch sich seine Milchquote so erhöht habe, dass sie ausreichte, die von dem Verkäufer selbst (bzw. dem vermeintlichen Pächter) vorgenommenen Lieferungen trotz des Übergangs der bereits bei Betriebsübergang für den Verkäufer festgesetzten Quote auf die Klägerin abzudecken. |
|
|
|
|
16 |
Diesem Vortrag ist das FG in tatsächlicher Hinsicht nicht weiter nachgegangen und es hat ihn in rechtlicher Hinsicht offenbar für nicht entscheidungserheblich gehalten. Der angebliche Übergang einer - zusätzlichen - Milchquote auf den Verkäufer ist indes für die Beurteilung der Abgabenpflicht der Klägerin im Streitfall von entscheidender Bedeutung; denn er bewirkt infolge der Erhöhung der dem Verkäufer im Streitjahr insgesamt zur Verfügung stehenden Milchquote, dass die auf die Klägerin übergegangene Quote, welche nunmehr nur noch einen Teil der dem Verkäufer in dem Milchwirtschaftsjahr insgesamt zur Verfügung stehenden Quote darstellte, entsprechend der mit der Klägerin getroffenen Vereinbarung in vollem Umfang beliefert werden konnte, weil die von der Quote des Verkäufers vorrangig abzubuchenden eigenen Milchlieferungen desselben - das tatsächliche Vorbringen der Klägerin als zutreffend unterstellt - durch die hinzuerworbene Quote abgedeckt waren und folglich die Nutzbarkeit der auf die Klägerin übergegangenen Quote nicht beeinträchtigten. |
|
|
|
|
17 |
Das ist dem FG - ebenso wie offenbar dem HZA - möglicherweise deshalb nicht deutlich geworden, weil der Verkäufer allerdings nach dem eigenen Vortrag der Klägerin im Zeitpunkt der Übergabe seines Betriebs an die Klägerin diese zusätzliche Milchquote noch nicht besaß. Die einschlägigen Vorschriften des Gemeinschafts- und des nationalen Rechts können indes nicht dahin ausgelegt werden, dass derjenige, auf den während eines Milchwirtschaftsjahres ein Milcherzeugungsbetrieb und die für diesen maßgebliche Milchquote übergegangen sind, nur in dem Umfang ein Recht zur abgabenfreien Milchlieferung erwirbt, in dem der abgebende Betrieb unter Berücksichtigung seiner Milchlieferungen in dem bereits verstrichenen Teil des Milchwirtschaftsjahres im Zeitpunkt des Übergangs eine (noch ungenutzte) Milchquote besessen hat, so dass - mag der vormalige Milcherzeuger sich weiterhin als Milcherzeuger betätigt haben oder z.B. eine Milchquote nachträglich nur erworben haben, um einer Verpflichtung zur Übertragung einer noch belieferbaren Milchquote nachkommen zu können - von dem vormaligen Milcherzeuger nach der Betriebsübergabe getätigte Rechtsgeschäfte, die den Übergang einer Milchquote auf denselben zur Folge haben, für das Milchlieferungsrecht des Erwerbers nicht von Bedeutung sein könnten. |
|
|
|
|
18 |
Die Milchquote ist, wie bemerkt, jahresbezogen. Erst am Ende des Milchwirtschaftsjahres lässt sich feststellen und ist festzustellen, wie groß sie ist. Denn Abgaben und Hinzuerwerbe während des Milchwirtschaftsjahres sind zu berücksichtigen (Art. 5 Buchst. k VO Nr. 1788/2003). Die Milchlieferungen während des Milchwirtschaftsjahres werden zusammengerechnet und nicht etwa einzelnen Monaten oder gar Zeitpunkten zugeordnet. Dass diese Grundsätze nicht gölten, wenn ein Betrieb während eines Milchwirtschaftsjahres von einem Milcherzeuger auf einen anderen übergeht, in diesem Falle also das Milchwirtschaftsjahr für die Abgabenberechnung gleichsam in zwei Teilzeiträume aufzuteilen ist, ist den einschlägigen Vorschriften nicht zu entnehmen. Mit Recht führt die Revision dagegen auch an, dass der Zweck der Milchabgabenregelung eine solche Aufteilung nicht verlange. |
|
|
|
|
19 |
Der erkennende Senat ist durch § 118 Abs. 2 FGO nicht gehindert, das vorgenannte Vorbringen, dass der Verkäufer des Betriebs der Klägerin vor dem Ende des Milchwirtschaftsjahres eine Milchquote hinzuerworben habe, bei seiner rechtlichen Würdigung zu berücksichtigen. Es handelt sich nicht um neues tatsächliches Vorbringen, das im Revisionsverfahren unzulässig wäre, sondern um Sachvortrag, den die Klägerin bereits in erster Instanz vorgebracht hat, wenn ihn auch das FG nicht beachtet hat. Die Sache muss deshalb gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO an das FG zurückgehen, damit dieses der Richtigkeit des betreffenden Sachvortrags der Klägerin nachgeht. Es wird dabei berücksichtigen können, dass der von der Klägerin geltend gemachte Übergang einer Milchquote von 617.690 kg durch die Bescheinigung der Landwirtschaftsbehörde vom 2.11.2005 nachgewiesen ist (§ 17 Abs. 1 MilchAbgV). Eine in entsprechender Anwendung eben genannter Vorschrift zu fordernde Bescheinigung über den Übergang der von dem Verkäufer nachträglich hinzuerworbenen Quote liegt allerdings bislang nicht vor. Dass sie von der Klägerin - offenbar aus Rechtsunkenntnis - nicht von sich aus im ersten Rechtsgang vorgelegt worden ist, rechtfertigt die Abweisung der Klage indes nicht. |
|
|
|
|
20 |
Sollte der Klägerin allerdings im zweiten Rechtsgang eine formgerechte Bestätigung des Übergangs einer solchen zusätzlichen Milchquote nicht gelingen, wird ihre Klage nach Sachlage abzuweisen sein. Denn mit Recht hat das FG erkannt, dass durch eine - zudem erst nachträglich geschlossene - Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer, ungeachtet der von jenem bereits vorgenommenen Milchlieferungen solle dessen Milchquote in vollem Umfang auf den Käufer übergehen, für die nach Maßgabe öffentlichen Rechts zu beantwortende Frage ohne Bedeutung ist, ob und ggf. zu wessen Lasten eine Milchabgabe entsteht. Dies beantwortet sich, wie ausgeführt, danach, ob die Milchlieferungen des Verkäufers und die Milchlieferungen des Käufers in dem betreffenden Milchwirtschaftsjahr in der jeweiligen Summe die für jeden von diesen festgesetzte bzw. auf ihn - nach Maßgabe der Bescheinigung der Landwirtschaftsbehörde - übergegangene Milchquote unter Berücksichtigung aller Abgaben und Hinzuerwerbe während des Milchwirtschaftsjahres übersteigen. Die einschlägigen Rechtsvorschriften schließen zwar eine abweichende Zuweisung der Abgabenlast aufgrund einer Vereinbarung zwischen den als Abgabenschuldner in Betracht kommenden Milcherzeugern nicht ausdrücklich aus; es liegt jedoch auf der Hand, dass es nicht dem Sinn der Milchabgabenregelung und den mit ihr vom Verordnungsgeber verfolgten Zielen entspräche, es der Disposition der Milcherzeuger zu überlassen, wer von mehreren in Betracht kommenden Milcherzeugern Abgabenschuldner werden möchte. |
|
|
|
|
21 |
Die zwischen der Klägerin und dem Verkäufer nachträglich geschlossene Vereinbarung nimmt indes unter den oben erörterten (bislang nicht festgestellten) Voraussetzungen in Wahrheit keine solche abweichende Zuordnung der Abgabenlast vor, sondern stellt sinngemäß lediglich der tatsächlichen Rechtslage entsprechend klar, dass der Klägerin das ihr übertragene Lieferrecht im Streitjahr unbeschadet der Milchlieferungen des Verkäufers ungeschmälert zur Verfügung stehen solle. |
|
|
|
|
22 |
Dass die Klägerin sich im Übrigen auch nicht darauf berufen könnte, sie habe darauf vertraut, eine Milchmenge von rund 620.000 kg in dem strittigen Milchwirtschaftsjahr liefern zu können, hat bereits das HZA in seiner Revisionserwiderung zutreffend dargelegt. Der erkennende Senat kann daher davon absehen, hierzu gemäß § 126 Abs. 5 FGO Näheres auszuführen. |